Für Ruth besaß die rundliche, hausbackene Kaiserin noch eine zusätzliche Bedeutung: Sie war die Hüterin der beiden großen Museen zu beiden Seiten des Platzes, der ihren Namen trug. Auf der Südseite stand das Kunsthistorische Museum, ein majestätischer Pseudo-Renaissancepalast, in dem die berühmten Gemälde Tizians und Holbeins hingen und die schönsten Brueghels der Welt. Und im Norden – sein Pendant bis auf die letzte kannelierte Säule und gezierte Kuppel – war das Naturhistorische Museum. Als Kind hatte sie beide Museen geliebt. Das Kunsthistorische Museum gehörte zu ihrer Mutter, angefüllt mit Erbauung, Leiden und Liebe – etwas sehr viel Liebe. Die Madonnen liebten ihre Kindlein, Jesus liebte die armen Sünder, und der heilige Franz liebte die Vögel.
Im Naturhistorischen Museum gab es keine Liebe, sondern nur Fortpflanzung. Dafür aber gab es dort Geschichten und Phantasiereisen und viel Arbeit. Dies war die Welt ihres Vaters, und wenn Ruth ihn dort besuchte, dann war sie nicht ein Kind wie alle anderen. Wenn sie sich nämlich an dem Helmkasuar in seinem Nest, dem See-Elefanten mit seinem gewaltigen Brustkasten und an den schimmernden Bändern der Schlangen in ihren mit farbiger Flüssigkeit gefüllten Behältern sattgesehen hatte, konnte sie durch eine Zaubertür gehen und wie Alice im Wunderland in eine geheime Welt eintreten.
Hier, hinter den vergoldeten, stillen Galerien mit ihren grauuniformierten Wächtern, befand sich ein Labyrinth von Präparierräumen und Labors, von Werkstätten und Büros. Hier wurde die wahre Arbeit des Museums geleistet. Hier war das Zentrum wissenschaftlicher Arbeit und fachlichen Wissens, dessen Wirken bis in die fernsten Länder reichte. Seit ihrer frühen Kindheit hatte Ruth bei dieser Arbeit zusehen und helfen dürfen. Manchmal galt es das Skelett eines Dinosauriers zusammenzusetzen; manchmal durfte sie Konservierungsmittel auf eine ausgespannte Tierhaut sprühen. Das Zimmer ihres Vaters war ihr so vertraut wie sein Arbeitszimmer in der Rauhensteingasse. Jetzt flüchtete sie sich, der Heimat und der Hoffnung beraubt, an diesen Ort.
Es war Dienstag, der Tag, an dem das Museum für die Öffentlichkeit geschlossen war. Leise öffnete Ruth die Seitentür und huschte die Treppe hinauf.
Im Zimmer ihres Vaters war alles so wie immer. Sein Labormantel hing hinter der Tür; seine Aufzeichnungen lagen neben einem Stapel Zeitschriften auf dem Schreibtisch. Auf dem Arbeitstisch am Fenster stand das Brett mit den fossilen Skeletteilen, die er zu sortieren begonnen hatte, als er das letzte Mal hiergewesen war. Noch hatte man das Schild mit seinem Namen nicht von der Tür genommen; noch hatte man die beiden Schlüsselringe, von denen sie einen bei der Hausmeisterin zurückgelassen hatte, nicht beschlagnahmt.
Sie stellte ihren Koffer neben den Aktenschrank und ging hinüber in den kleinen Garderobenraum, in dem es auch einen Gasring und einen Wasserkessel gab. Nebenan war ein Präparierzimmer mit Borden voller Flaschen und einem Feldbett, auf dem manchmal Wissenschaftler oder Laboranten ein Nickerchen machten, wenn sie sehr lange arbeiten mußten.
«Lieber Gott, mach, daß er kommt», betete Ruth laut.
Aber weshalb sollte er kommen, dieser Engländer, der ihr nichts schuldete? Wer wußte, ob er überhaupt die Schlüssel bekommen hatte, die sie bei der Hausmeisterin für ihn hinterlassen hatte. Ohne zu überlegen, was sie tat, zog sie einen Hocker an den Arbeitstisch, auf dem das Brett mit den Skeletteilen stand, und begann mit geübten Händen, die Wirbelknochen herauszusuchen und sie von Erde und kleinen Steinchen zu reinigen. Das Haar fiel ihr ins Gesicht, als sie sich vorbeugte; sie faßte es, drehte es im Nacken zusammen und stieß den Stiel eines Pinsels durch die Nackenrolle. Das hatte sie von einer japanischen Kommilitonin gelernt.
Die Stille war greifbar. Es war früher Abend geworden; die Museumsangestellten waren alle nach Hause gegangen. Nicht einmal die Wasserleitungen und der Aufzug machten die üblichen Geräusche. Gewissenhaft und völlig sinnlos fuhr Ruth fort, die Knochen des urzeitlichen Höhlenbären zu ordnen, und wartete ohne Hoffnung auf den Engländer.
Als sie das Knirschen des Schlüssels im Türschloß hörte, wagte sie nicht, den Kopf zu drehen. Sie hörte die Schritte, deren Klang erstaunlicherweise schon vertraut war, dann schob sich ein Arm über ihre Schulter, und flüchtig fühlte sie den Stoff seines Jacketts an ihrer Wange.
«Nein, der ist es nicht», sagte er ruhig. «Der paßt nicht, das werden Sie gleich sehen. Sie brauchen sich nur die Größe des Wirbellochs anzuschauen.»
Sie lehnte sich auf ihrem Hocker zurück und fühlte sich mit einemmal so sicher wie früher, wenn ihr Klavierlehrer seine Hand auf die ihre gelegt und ihr bei einer schwierigen Passage die Finger geführt hatte.
«Wie schnell das bei Ihnen geht», sagte sie, während sie zusah, wie seine Finger in den Knochenfragmenten umhersprangen. Dann fragte sie: «Und beim Konsulat haben Sie wohl kein Glück gehabt?»
«Nein. Aber wir bringen Sie schon weg hier. Was ist eigentlich in der Wohnung Ihrer Eltern passiert? Konnten Sie noch etwas retten?»
Sie wies auf ihren Koffer. «Ja, Frau Hautermann hat mich vorgewarnt.»
«Die Hausmeisterin?»
«Ja. Ich habe schnell ein paar Sachen gepackt und bin verschwunden. Sie hatten es nicht auf mich abgesehen. Diesmal noch nicht.»
Er schwieg, sortierte immer noch automatisch die Skeletteile. Dann schob er das Arbeitsbrett weg.
«Haben Sie heute schon etwas gegessen?»
Sie schüttelte den Kopf.
«Gut. Ich habe ein Picknick mitgebracht. Etwas ganz Besonderes. Wo wollen wir essen?»
«Wohl am besten hier. Ich kann den Tisch abräumen und von nebenan einen zweiten Stuhl holen.»
«Ich habe Picknick gesagt», erklärte Quin streng. «In England heißt das, daß man sich irgendwo auf die Erde setzt, vorzugsweise möglichst unbequem und im Regen. Also, wo halten wir unser Picknick ab? In Afrika? Es gibt hier, wie ich gesehen habe, eine prachtvolle Löwenkollektion; sie sind vielleicht ein wenig von den Motten angenagt, aber sehr gut präpariert. Es käme auch das Amazonasgebiet in Frage. Für Anacondas habe ich immer schon eine Schwäche gehabt, Sie nicht? Nein, Moment mal, wie wär's mit der Arktis? Ich habe einen vorzüglichen Chablis mitgebracht, und den trinkt man am besten gut gekühlt.»
Ruth schüttelte den Kopf. «Der Eisbär gehörte zu meinen Lieblingstieren, als ich noch klein war, aber ich möchte mir keine Frostbeulen holen – sonst fallen mir womöglich noch die Brote aus der Hand. Hätten Sie nicht Lust, ein Stück rückwärts in der Zeit zu reisen? Zu den Dinosauriern vielleicht?»
«Nein. Das riecht mir zu sehr nach Arbeit. Und ich bin mit diesem Ichthyosaurus hier, ehrlich gesagt, nicht allzu glücklich. Wer immer dieses Skelett zusammengesetzt hat, hatte eine Menge Phantasie.»
Ruth errötete. «Das war der alte Schumacher. Er war schwerkrank und wollte es vor seinem Tod unbedingt noch fertig kriegen.» Sie schwieg einen Moment. «Ich hab's!» rief sie dann. «Gehen wir nach Madagaskar. Zum Urkontinent Lemuria. Da gibt es ein Fingertier, ein Junges – das sieht so schön traurig aus. Es wird Ihnen bestimmt gefallen.»
Quin nickte. «Also gut, wir begeben uns nach Madagaskar. Vielleicht können Sie uns ein Handtuch oder eine Zeitung besorgen; mehr brauchen wir nicht. Es verstößt bestimmt gegen die Vorschriften, hier ein Picknick abzuhalten, aber von solchen Kleinigkeiten lassen wir uns nicht stören, hm?»
Sie ging nach nebenan in die kleine Garderobe und kam mit einem gefalteten Handtuch und offenem Haar zurück. Über ihr Gesicht mit seinen kontrastierenden Zügen konnte man geteilter Meinung sein, dachte Quin, nicht aber über dieses herrlich ungebändigte und völlig unmodische Haar. Im Licht der letzten Strahlen der sinkenden Sonne leuchtete es in einem warmen, sanft goldenen Schein, der einem ans Herz griff.
Seltsam war diese Wanderung durch die hohen dämmrigen Räume, in denen Geschöpfe sie beobachteten, die für immer in ihrem kleinen Moment der unendlichen Zeit eingefroren waren. Antilopen nicht größer als Katzen standen auf dem Sprung, bereit, über das sandige Feld zu fliehen. Die Affen der Neuen Welt hingen mit melancholischen kleinen Gesichtern von Baumästen herab – und an einem Fenster saß eine Dronte, die ausgestorbene plumpe Riesentaube, auf einem Nest mit falschen Eiern.
Madagaskar hielt alles, was Ruth versprochen hatte. Halbaffen mit gestreiften Schwänzen und gescheckten Gesichtern hielten Nüsse in ihren verblüffend menschlich aussehenden Händen. Zwei Indris, wuschelig wie Kinderspieltiere, lausten einander.
Und allein, dicht hinter dem Glas, das Fingertier – ein Jungtier, häßlich und schwermütig, mit großen traurigen Augen, nackten Ohren und einem ausgestreckten Finger, drohend wie der einer Hexe.
«Ich weiß selbst nicht, warum ich den kleinen Kerl so gern habe», sagte Ruth. «Vielleicht weil er irgendwie ein Ausgestoßener ist – so häßlich und einsam und traurig.»
«Er hat allen Grund, traurig zu sein», meinte Quin. «Die Eingeborenen haben Todesangst vor ihm – sie laufen mit Zeter und Mordio davon, wenn sie einen zu Gesicht bekommen. Einen Stamm habe ich allerdings gefunden, da glaubt man, daß sie die Macht besitzen, die Seelen der Toten in den Himmel zu tragen.»
Sie wandte sich ihm gespannt zu. «Natürlich, Sie waren ja dort. Mit der französischen Expedition? Es muß ein wunderbares Land sein. Wie ich Sie beneide! Ich wollte mit meinem Vater reisen, sobald ich mein Studium beendet habe, aber jetzt ...» Sie zog ihr Taschentuch heraus und setzte von neuem an. «Ich bin sicher, dieser Stamm hat recht», sagte sie, sich wieder dem Fingertier zuwendend. «Ich kann mir vorstellen, daß sie die Seelen der Toten in den Himmel tragen.» Einen Moment schwieg sie, den Blick auf das ausgestopfte kleine Geschöpf hinter dem Glas gerichtet. «Du kannst meine Seele haben», flüsterte sie. «Jederzeit.»

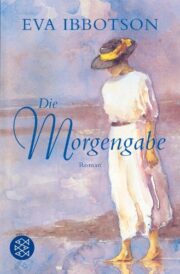
"Die Morgengabe" отзывы
Отзывы читателей о книге "Die Morgengabe". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Die Morgengabe" друзьям в соцсетях.