Hengate starrte Stokes herausfordernd an. »Und Ihr? Was macht Ihr, wenn wir beschließen, nach Hause zurückzukehren und einfach abzuwarten, wie das Ganze endet?«
Stokes zuckte mit den Schultern. »Ich würde ebenfalls zurückkehren und meiner Herrin mitteilen, dass der Herzog einen neuen Spürhund benötigt. Demjenigen, den er ausgesandt hat, sind offenbar seine Fähigkeiten abhandengekommen.«
Die Männer brachen in dröhnendes Gelächter aus. Nach kurzem Zögern trottete Hengate zu seinem Pferd und schwang sich in den Sattel, ehe er zu Stokes sagte: »Falls Ihr uns verratet, sollt Ihr wissen, dass der Arm meines Herrn, Lord Pembroke, lang ist. Er wird Euch finden, gleichgültig, hinter wessen Röcken Ihr Euch verbergt.«
»Ich bin kein Informant«, schnaubte Stokes. »Was immer sich bei den Dudleys ereignet, betrifft mich nicht. Und meine Herrin ebenso wenig, das kann ich Euch versichern.«
»Sehr gut«, brummte Hengate, während seine Komplizen nun ebenfalls aufstiegen. »In Zeiten wie diesen ist es der geschmeidige Mann, der überlebt.« Damit rammte er seinem Tier die Fersen in die Seiten und stob, gefolgt von den anderen, davon. Zurück blieb Stokes, der mit der vornehm behandschuhten Hand vor seiner Nase wedelte, als wollte er einen störenden Geruch vertreiben.
Gerade traf er Anstalten, sich seinem träge herumstehenden Ross zuzuwenden, als mein Pfeil über seinen Kopf hinwegzischte. Er wirbelte herum und betrachtete die Felsbrocken mit einem Hochmut, den ich bei einem Mann in seiner Lage wirklich nicht erwartet hatte.
Ich trat vor. Im Gehen zog ich einen weiteren Pfeil aus dem Köcher und spannte ihn in den Bogen. Das war einer der wenigen Momente in meinem Leben, in denen ich die Gelegenheit hatte, das jahrelang Geübte tatsächlich anzuwenden. So war ich ganz und gar nicht enttäuscht, als Stokes vorsichtig zurückwich.
»Was wollt Ihr?«, fragte er. »Geld?« Er zog eine Börse unter seinem Gürtel hervor und warf sie auf den Weg zwischen uns. »Das müsste genügen.«
Ich schob meine Kappe zurück. »Erkennt Ihr mich denn nicht? So lange ist es doch nicht her!«
Er glotzte mich an. »Das … das kann nicht sein.«
Ich legte den Bogen an und richtete den Pfeil genau zwischen seine Schenkel. »Ich stelle mir vor, dass Euch ein stundenlanges Sterben bevorsteht, wenn ich Euch dort treffe.« Ich richtete den Pfeil höher. »Ich könnte ebenso zwischen die Augen schießen. Oder aber Ihr fangt an zu reden. Ihr habt die Wahl.«
Mit einem Knurren riss er seinen Degen aus der Scheide.
Ich schoss den Pfeil ab. Er traf Stokes im Oberschenkel. Heulend sank der Mann auf die Knie. Bleich vor Schock packte er den Pfeil am Schaft. Es floss kaum Blut. Ich trat auf ihn zu und drückte den Pfeil wieder fest in die Wunde. Den Schmerz in meiner Schulter ignorierte ich.
Während ich erneut zielte, schrie Stokes mit hassverzerrtem Gesicht: »Du Hurensohn! Du würdest einen wehrlosen Mann kaltblütig ermorden!«
Ich wartete. »Das ist schon mal ein guter Anfang. Ein Hurensohn. Bin ich das wirklich?«
»Ein Mörder bist du! Ich werde verbluten!«
»Nicht, wenn Ihr diesen Pfeil stecken lasst. Ihr braucht einen erfahrenen Chirurgen, der ihn Euch herausoperiert. Die Spitze hat einen Widerhaken. Ohne die richtige Pflege wird die Wunde schwären. Trotzdem sind Eure Aussichten zu überleben immer noch besser als die, die Ihr mir gelassen habt.« Ich senkte den Bogen. »Zurück zu meiner Frage: War meine Mutter eine Hure?«
»Das weiß ich nicht«, fauchte er, zitterte jedoch dabei.
»Ich glaube, das stimmt nicht.« Ich kauerte mich vor ihm nieder. »Die Herzogin schien es jedenfalls zu wissen. Sie hat das Muttermal an meiner Hüfte gesehen und war mit einem Mal gewillt, mich zu töten. Warum wünscht sie sich meinen Tod? Für wen hält sie mich?«
»Für wen genau?«, kreischte er und warf sich plötzlich mit einem gewaltigen Satz auf mich, sodass ich auf den Rücken fiel, er auf mir landete und der Pfeilköcher unter unserem Gewicht zerquetscht wurde. Mein Hinterkopf schlug auf dem Weg auf. Einen Moment lang zerschmolz die Welt um mich herum. Dann rammte ich ihm beide Knie in die Rippen und zerrte am Schaft des Pfeils. Kreischend ließ er von mir ab. Das aus der Wunde schießende Blut tat ein Übriges. Ich wälzte mich zur Seite und warf Stokes ab. Bevor er reagieren konnte, schnellte ich hoch und trat den Bogen aus seiner Reichweite. Mit gezücktem Dolch warf ich mich dann auf Stokes’ Rücken, sodass er nicht mehr hochkam. Wütend presste ich ihm die Klinge an die Kehle und drückte seine Wange in den Staub.
»Soll ich?«, zischte ich. »Soll ich Euch hier und jetzt abstechen und einfach verbluten lassen? Oder wollt Ihr mir sagen, was ich wissen will?«
»Nein! Nein! Bitte!«
Ich ließ ihn los. Keuchend blieb Stokes im Staub liegen. Aus seinem Bein sickerte Blut.
Mit einem Ruck drehte ich ihn auf den Rücken. Während ich die Klinge meines Dolchs an die Stelle hielt, aus der der Pfeil ragte, knurrte ich: »Ich verspreche Euch: Das wird wehtun. Und wenn ich die Spitze herausschneide, werden die Schmerzen schlimmer sein, als Ihr es Euch vorstellen könnt. Aber vielleicht sind sie weniger schlimm, wenn Ihr die Luft nicht anhaltet.«
Ich unterstrich meine Worte mit einem eisigen Lächeln. Schwarze Wut brach aus meinem Herzen hervor, eine plötzliche, unbeherrschbare Rachgier. Vor meinem inneren Auge sah ich erneut Stahl aufblitzen, sah ein verstümmeltes Wesen in sich zusammensacken. Eilig richtete ich mich auf und barg den Bogen.
Stokes starrte mich voller Entsetzen an, als ich einen unversehrt gebliebenen Pfeil entdeckte, in den Bogen legte und zielte. In panischer Angst wirbelte er herum – zu spät. Mit kalter Präzision schoss ich. Der Pfeil sirrte durch die Luft, verfehlte sein Ohr haarscharf und nagelte seinen aufgebauschten Umhang am Boden fest.
Sich heftig windend, zerrte er daran, in einem verzweifelten Versuch, sich von dem Pfeil zu befreien. »Ich gebe auf!«, kreischte er. »Ich sag dir alles, was du wissen willst. Schneid mich los, und scher dich dann zum Teufel!«
»Ich will eine Antwort auf meine Frage.«
Jäh stieß er ein irrsinniges Kichern aus. »Du Narr! Du bist völlig ahnungslos, was? Wir wollten dich ertrinken lassen und deine Leiche in den Fluss werfen, und du hättest nie erfahren, warum überhaupt.«
Ich presste die Zähne aufeinander. »Du wirst es mir verraten. Jetzt!«
»Na gut.« Pure Bosheit glomm in seinen verschlagenen Augen. »Du bist das letzte Kind der Herzogin Mary von Suffolk, der jüngsten Schwester von Henry dem Achten, die in ihrer Familie auch die Tudor-Rose genannt wurde. Dieses Muttermal, das du hast – du hast es von ihr geerbt, bist damit auf die Welt gekommen. Sie hatte es auch. Die Einzigen, die davon gewusst haben dürften, sind diejenigen, die mit der verstorbenen Herzogin eng vertraut waren.«
Mein Atem ging stoßweise. Ein Rauschen in meinen Ohren übertönte jedes Geräusch um mich herum. Während ich den Mann vor mir anstarrte, zogen in einer beängstigend präzisen Abfolge all die Ereignisse an mir vorbei, die mich zu dieser unfassbaren Begegnung hier und jetzt geführt hatten.
Mir stieg der Geschmack von Galle in die Kehle. »Soll das heißen, dass die Herzogin glaubt …?« Ich verstummte, brachte es nicht über mich, die Worte auszusprechen.
»Ich hab dir gesagt, was du wissen wolltest!«, rief Stokes hämisch. »Jetzt lass mich frei!«
Ich fühlte mich, als würde ich in ein bodenloses Loch stürzen, doch dann hob ich die Finger an meine Lippen und pfiff. Sofort trottete Cinnabar herbei. Aus der Satteltasche kramte ich Kates Salbe hervor und das Leinentuch, das sie für meine Schulter eingepackt hatte. Dann beugte ich mich über Stokes, zog ihm die blutverschmierte Hose herunter, schnitt den Pfeil am Schaft ab, trug die Salbe auf und versorgte die Wunde. Danach drehte ich den zweiten Pfeil aus Umhang und Boden heraus.
Ich blickte ihm in das aschfahle Gesicht. »Ihr braucht trotzdem noch einen Chirurgen, der Euch die Spitze herausschneidet. Seht zu, dass Ihr so schnell wie möglich einen findet. Sonst eitert die Wunde.« Ich streckte ihm die Hand entgegen. »Kommt, ich helfe Euch auf Euer Pferd.«
Er glotzte mich an. »Du lauerst mir auf, um Pfeile auf mich abzuschießen, und jetzt hilfst du mir aufs Pferd? Dann bist du wirklich einer von ihnen! Du bist genauso verrückt wie der alte Henry selbst!«
»Still. Kein Wort mehr!« Ich packte seine Hand und riss ihn hoch. Er schrie auf, als ich seinen Fuß in den Steigbügel hob und ihn in den Sattel stemmte. Benommen ergriff er die Zügel und zog kräftig daran.
Schon wieder der Hochmut in Person, wendete er das Pferd zu mir herum. Ich stellte mich seinem bösartigen Blick, in dem Wissen, dass er sich anschickte, mir eine Wunde zuzufügen, die noch viel tiefer war als alles, was ich mit einem Pfeil auszurichten vermochte.
»Deine Mutter«, sagte er voller Häme, »ihre Mutter – sie hat dich heimlich auf die Welt gebracht, ehe sie am Kindbettfieber gestorben ist. Sie hatte keiner Menschenseele etwas von ihrer Schwangerschaft verraten, außer ihrer ältesten Tochter, der sie traute. Sie war verrückt vor Angst. Sie flehte ihre Tochter an, das Geheimnis zu wahren. Und sie verbarg ihre Schwangerschaft vor allen, sogar vor ihrem Mann, der damals fast das ganze Jahr am Hof verbrachte. Aber irgendetwas muss in diesen letzten Stunden geschehen sein. Mary von Suffolk muss sich der Hebamme anvertraut und etwas geäußert haben, das bei ihr Verdacht erregte, denn meiner Herrin wurde später mitgeteilt, du wärst eine Totgeburt gewesen. Sie lebte damals am Hof und gab den Befehl aus, dass man deine Leiche beseitigen und die Angelegenheit vertuschen solle. Hätte sie gewusst, dass du noch am Leben warst, wäre sie auf der Stelle den ganzen Weg von Whitehall hergeritten und hätte dich höchstpersönlich erdrosselt. Verstehst du, du könntest ihr alles nehmen – Landgut und Titel, ihren Rang am Hof und in der Thronfolge. Du bist der Sohn, den Charles Brandon sich ersehnt hatte, der Erbe des Herzogtums Suffolk. Denk gefälligst daran, wenn du das nächste Mal wieder einen Stall ausmistest.«

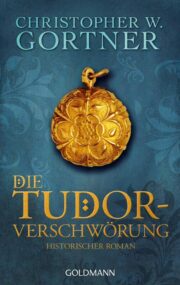
"Die Tudor-Verschwörung" отзывы
Отзывы читателей о книге "Die Tudor-Verschwörung". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Die Tudor-Verschwörung" друзьям в соцсетях.