»Vergebt mir.« Ich verneigte mich. »Ich wollte Eurer Hoheit keinen Kummer bereiten.«
»Mir geht es weit mehr um den Kummer, den mir der Herzog bereitet.« Sie richtete die volle Kraft ihres Blicks auf mich. »Ihr seid dort Diener. Wisst Ihr, was er im Schilde führt?«
Ich zögerte. Master Sheltons Worte klangen mir noch in den Ohren. Sie ist das reinste Gift, genau wie ihre Mutter.
Noch während ich überlegte, wusste ich schon, dass ich mich nicht abwenden, ihrer Frage nicht ausweichen würde, selbst wenn mich das am Ende alles kosten konnte. Ich war an dem unvermeidlichen Scheideweg angelangt, den jeder Mensch irgendwann in seinem Leben erreicht – jenem Moment, da wir, wenn wir das Glück haben, es zu bemerken, eine Entscheidung treffen, die unser ganzes Leben verändert. Elizabeth war das auslösende Element, nach dem ich unwissentlich gesucht hatte; ob giftig oder gutartig, sie bot mir die Chance zu einem neuen Dasein.
»Ich weiß es nicht«, antwortete ich. »Wenn ich es wüsste, würde ich es Euch sagen. Aber ich habe Augen und Ohren; ich habe gesehen, was heute Abend passiert ist, und ich fürchte, was immer er im Schilde führt, es wird für Eure Hoheit nichts Gutes bedeuten.«
Sie neigte abwägend den Kopf. »Nun, zumindest wisst Ihr Euch auszudrücken. Doch ich muss Euch warnen: Ihr bewegt Euch auf unsicherem Boden. Seht Euch vor, wohin Ihr den Fuß setzt, Junker.«
Ich ließ mich nicht beirren. »Ich melde nur das, was ich sehe. Ich habe schon früh im Leben gelernt, hinter die Fassade der Dinge zu schauen.«
Der Anflug eines Lächelns spielte um ihre Lippen. »Anscheinend haben wir da etwas gemeinsam.« Sie verstummte für einen kurzen Moment, und das Schweigen stellte die unsichtbare Grenze zwischen Königskind und gewöhnlichen Menschen wieder her.
»Also, ich höre. Was habt Ihr beobachtet, das Euch auf den Gedanken bringt, ich könnte in Gefahr sein?«
Die unterschwellige Drohung in ihrer Stimme blieb mir nicht verborgen. Dies war in der Tat trügerischer Boden, nicht irgendein Märchen, in dem ich den tapferen Ritter spielen konnte. Wir waren hier am Königshof, wo das Einzige, was zählte, die Macht war. Sie war in diesem Treibsand aufgewachsen, schmeckte seine Salzlauge, seit sie alt genug gewesen war, die Wahrheit über den Tod ihrer Mutter zu erfahren. Doch ob sie es nun eingestand oder nicht, sie wusste, dass wir beide nur Schachfiguren in einem Spiel der Dudleys waren. Das war der einzige Grund, weshalb ich mich nicht davonmachen konnte: Es gab kein Entkommen.
»Ich habe gesehen, dass Ihr überrascht davon wart, nicht zu Seiner Majestät vorgelassen zu werden. Ihr hattet erwartet, dass er im Thronsaal sein und Euch begrüßen würde, was er mit Sicherheit auch getan hätte, wäre er wirklich auf dem Weg der Genesung. Jetzt fürchtet Ihr Euch, weil Ihr nicht wisst, wie es ihm geht und was der Herzog mit ihm gemacht hat.«
Sie schwieg, reglos wie eine Statue. »Ihr seid wirklich scharfsichtig. Mit solchen Augen könnt Ihr es noch weit bringen. Aber wenn Ihr schon so viel seht, dann möge mich Gott vor denen schützen, die noch mehr Weitsicht besitzen, denn natürlich war jene Travestie im Thronsaal als Warnung an alle gedacht, dass von jetzt an John Dudley, Herzog von Northumberland, dieses Königreich regiert.«
Ich musste gegen den Drang ankämpfen, mich umzuschauen, denn ich erwartete fast schon, den Herzog auf leisen Sohlen herankommen zu sehen, gefolgt von seinen schwarz gekleideten Ratsmitgliedern, allesamt ausgestattet mit der Vollmacht zu unserer Verhaftung.
»Weiß Robin von Eurem Verdacht?«, fragte sie.
Ich schluckte. Es lag mir auf der Zunge, ihr zu sagen, was ich von Robert hielt und was da soeben für ein seltsamer Wortwechsel zwischen Lady Dudley und der Herzogin von Suffolk bezüglich meiner Wenigkeit stattgefunden hatte. Doch alles, was ich hatte, waren nur Verdachtsmomente, und so zog ich es instinktiv vor zu schweigen. Was auch immer die Dudleys mit mir vorhaben mochten, es hatte nichts mit ihr zu tun – noch nicht.
»Eure Hoheit«, sagte ich schließlich, »ich weiß nicht, ob Lord Robert vertrauenswürdig ist. Aber wenn Ihr es befehlt, werde ich versuchen, es herauszufinden.«
Unversehens lachte sie auf, laut und unbefangen, und ebenso plötzlich brach ihr Lachen wieder ab. »Ich glaube wahrhaftig, dass Ihr genau das tun würdet, was Ihr sagt. Offensichtlich hat deren Verderbtheit Euch noch nicht angesteckt.« Sie lächelte traurig. »Was ist es denn, was Ihr Euch von mir ersehnt, mein tapferer Junker? Streitet es nicht ab. Ich sehe es Euch an. Auch mir ist die Sehnsucht nicht fremd.«
Als hätte ich die Antwort schon die ganze Zeit parat gehabt, ohne zu wissen, ob der Moment dafür je kommen würde, platzte ich heraus: »Ich möchte Eurer Hoheit helfen, wohin mich das auch führen mag.«
Sie krampfte die Hände ineinander und blickte hinab zu den Weinflecken, die ihren Rocksaum besudelten. »Ich hatte nicht erwartet, heute Abend einen neuen Freund zu finden.« Sie hob den Blick zu mir. »Sosehr ich das Angebot zu schätzen weiß, muss ich es dennoch ablehnen. Es würde Euer Verhältnis zu Eurem Herrn trüben, das ohnehin nicht sehr gefestigt zu sein scheint. Gegen Geleit zu meinem Boot habe ich allerdings nichts einzuwenden. Meine Damen warten sicher schon dort.«
Trotz eines Gefühls plötzlicher Leere verneigte ich mich beflissen. Sie streckte die Hand aus und berührte mich am Ärmel. »Einen Begleiter«, sagte sie, »der mir Schutz gewährt. Ich gehe voran.«
Ohne ein weiteres Wort führte sie mich durch den Hof und zurück durch den Irrgarten aus stillen, mit Gobelins behängten Säulengängen, vorbei an Kassettenfenstern mit dicken Samtvorhängen, zwischen denen ich hier und da einen Blick auf mondhelle Innenhöfe und Gärten erhaschte. Ich fragte mich, was sie wohl empfand in diesem Palast, der von ihrem Vater für ihre Mutter erbaut worden war, Monument einer Leidenschaft, die England ausgezehrt hatte. Ich konnte nichts in ihrer Miene lesen, das auf irgendeine Gefühlsregung schließen ließ.
Wir kamen in dem nebeldurchwobenen Garten heraus, der zum Bootssteg führte. In banger Erwartung standen dort schon die Gefährtinnen. Mistress Ashley kam sogleich mit dem Umhang der Prinzessin herbeigestürzt, doch Elizabeth hob Einhalt gebietend die Hand. Die andere Begleiterin, Mistress Stafford, blieb stehen, wo sie war, in ihr goldbraunes Cape gehüllt.
Bei ihrem Anblick befiel mich die Sorge, Elizabeth könnte eine Schlange an ihrem Busen nähren. Diese Frau war wirklich höchst undurchsichtig.
Die Prinzessin wandte sich noch einmal mir zu. »Ein weiser Mann sollte jetzt auf seine Sicherheit achten. Die Dudleys brauen einen Sturm zusammen, der das ganze Reich zerfetzen könnte, und wenn es überhaupt eine Gerechtigkeit gibt, werden sie dafür bezahlen. Ich würde lieber nicht mit ihnen in Verbindung gebracht werden – so mancher hat schon für weniger den Kopf eingebüßt.« Sie setzte sich in Bewegung. »Lebt wohl, Junker. Ich glaube nicht, dass wir noch einmal Gelegenheit haben werden, uns zu begegnen.«
Sie schritt über den Steg zu ihrem Boot. Der Umhang wurde ihr über die Schultern gelegt. Von ihren Damen flankiert, stieg sie die Stufen hinab. Kurz danach hörte ich die Ruder des Bootsmanns ins Wasser eintauchen, während die steigende Flut die Prinzessin eilends davontrug, fort vom Hof, fort von mir.
Nachdem sie meinen Blicken entschwunden war, versuchte ich, mich zu beruhigen. Sie hatte meine Hilfe abgelehnt, aber nur, weil sie besorgt um mich war. Sosehr es mich schmerzte, hoffte ich doch, sie würde London verlassen, solange es ihr noch möglich war. Dieser Hof, dachte ich, Master Cecils warnender Worte eingedenk, war nicht sicher. Nicht für sie.
Für keinen von uns.
Ich strich mit der Hand über mein Wams und spürte den Ring in der Tasche. Ich hatte bei meinem ersten – und vermutlich auch letzten – Auftrag für Robert Dudley versagt. Jetzt kümmerte ich mich besser um meine eigene Sicherheit.
Ich marschierte zurück in den Palast. Nach – wie es mir schien – stundenlangem ziellosen Umherirren fand ich zufällig zu den Stallungen, wo die Hunde, die Augen etwas verquollen, mich mit trägem Kläffen begrüßten, während die Pferde in ihren bunten Boxen weiter schlummerten. Nachdem ich mich vergewissert hatte, dass Cinnabar gut untergebracht und mit genügend Hafer in seiner Krippe versorgt war, suchte ich mir eine grobe Pferdedecke, streifte Wams und Stiefel ab und kuschelte mich ins Stroh. Die raue Decke wickelte ich um mich, als ob sie aus feinstem Leinen wäre.
Es war warm und behaglich hier, und es roch nach Heimat.
9
Ich wachte vollkommen desorientiert auf, glaubte, ich wäre wieder daheim auf Dudley Castle und im Pferdestall über einem entwendeten Buch eingenickt. Schläfrig tastete ich nach dem Buch, als die Erinnerung zurückkehrte.
Ich musste grinsen. Nicht gerade der günstigste Auftakt für eine Karriere am Hof, dachte ich, während ich mich auf einen Ellbogen stützte und nach meinen Stiefeln griff.
Jäh erstarrte ich.
Neben dem Heuballen, die Hand in meinem Wams vergraben, hockte ein junger Stallknecht.
Ich lächelte. »Wenn du das da suchst« – ich reckte die Börse hoch –, »die behalte ich beim Schlafen immer am Leib.«
Der Junge sprang auf. Mit den zerzausten dunklen Locken und den großen, erschrockenen Augen sah er aus wie ein Engel. Ich erkannte ihn sofort wieder. Es war der gleiche Bursche, dem ich gestern Cinnabar anvertraut hatte, der mit der gierigen Hand. Unter seiner schlichten Tracht aus Sackleinen und Leder war er dürr. Offenbar wusste er aus eigener Erfahrung, was Hunger bedeutete. Ein niederer Stalljunge, vielleicht ebenfalls Waise. London war voll davon, und wo sonst konnte ein elternloser, mittelloser Junge Arbeit finden, wenn nicht im großen Räderwerk des Königshofs?

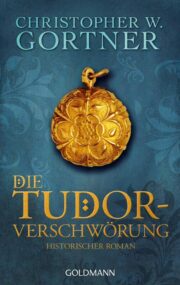
"Die Tudor-Verschwörung" отзывы
Отзывы читателей о книге "Die Tudor-Verschwörung". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Die Tudor-Verschwörung" друзьям в соцсетях.