Neben einer Anrichte unweit der noblen Gesellschaft lungerte Master Shelton.
6
Ich watete durch eine Flut von Höflingen und wich einem Ansturm von Dienern, die mit Tabletts beladen waren, aus, während ich auf eine Gruppe von Damen in mächtigen Gewändern zusteuerte, die mir den Weg versperrten.
Abrupt riss mich jemand am Ärmel zu sich herum.
»Was machst du hier?«, zischte Master Shelton.
Aus seinem Mund schlug mir Weindunst entgegen, als er mich zur Anrichte zog. Er runzelte böse die Stirn, wie sonst nur, wenn die Haushaltsbilanz nicht stimmte oder wenn er einen der Forstaufseher des Herzogs beim Wildern erwischte.
»Na, willst du nicht antworten?«, fuhr er mich an. »Wo ist Lord Robert?«
Ich beschloss, so wenig preiszugeben wie möglich. »Seine Gnaden, der Herzog, hat ihn zum Tower geschickt, irgendetwas zu erledigen. Und mir hat er befohlen, auf ihn zu warten.« Während ich sprach, teilte sich vor meinen Augen zufällig die Menge, und ich erhaschte einen Blick auf die Prinzessin, die bei den Sesseln am Kamin stand.
»Dann hättest du ihn begleiten sollen«, tadelte Shelton. »Ein Junker darf nie von der Seite seines Herrn weichen.«
Elizabeth unterhielt sich mit einem schmächtigen Mädchen, das in einem jener monumentalen Sessel saß. Das Mädchen trug ein schlichtes Gewand, das dem von Elizabeth ähnelte, ebenso wie ihr kupferfarbenes Haar und ihr blasser Teint, nur dass ihrer von Sommersprossen durchsetzt war. In dem Sessel neben ihr fläzte sich mit gerötetem Gesicht kein anderer als Guilford Dudley.
»Hör auf zu glotzen!«, herrschte Master Shelton mich an. Doch seine Miene war starr vor Anspannung, und auch er konnte den Blick nicht von Elizabeth wenden, die über irgendetwas lächelte, was das Mädchen gesagt hatte. Tastend, ohne hinzuschauen, griff er nach seinem Becher, und während er den Inhalt hinunterkippte, fiel mir ein, dass ich ihn im Dienst noch nie betrunken gesehen hatte. Aber vielleicht war er ja heute Abend nicht im Dienst. Vielleicht hatte ihn Lady Dudley für heute beurlaubt. Was ich allerdings bezweifelte. Seit ich ihn kannte, war Master Shelton immer im Dienst gewesen.
»Wer ist das?«, fragte ich, um ihn wenigstens der Form halber ins Gespräch zu ziehen. Gleichzeitig überlegte ich, wie ich den Ring abgeben konnte, der mir in der Tasche brannte.
»Na, wer schon?«, knurrte er. »Bist du blind? Lord Guilford natürlich, wer denn sonst?«
»Ich meine die Dame neben Lord Guilford.«
Lange blieb er stumm. »Lady Jane Grey«, fauchte er schließlich, und mir war, als hörte ich einen schmerzlichen Unterton in seiner Stimme. »Die älteste Tochter Ihrer Gnaden, der Herzogin von Suffolk.«
»Suffolk?«, wiederholte ich, und er fügte ungeduldig hinzu: »Ja, Jane Greys Mutter ist die Tochter der verstorbenen französischen Königin Mary, der jüngsten Schwester unseres Königs Henry selig.« Er trank noch einen Schluck Wein. »Nicht, dass dich das etwas anginge.«
Dieses schmächtige Mädchen sollte das Luder sein, das Guilford gestern das Bier vergällt hatte? Das kam mir eigenartig vor, und ich war schon im Begriff, weiter nachzufragen, als eine andere Gestalt meine Aufmerksamkeit auf sich zog.
Elizabeths zweite Gefährtin hatte ihren Umhang irgendwo abgelegt und bewegte sich selbstsicher durch die Menge, in ein bernsteinfarbenes Samtkleid gewandet, das sich hübsch zu ihren umbrabraunen, von einem halbmondförmigen Diadem gehaltenen Locken ausnahm. Mit ihrer jugendfrischen Grazie und natürlichen Ausstrahlung fiel sie angenehm unter all den geschniegelten, angemalten Hofschranzen auf. Zuerst vermutete ich, dass sie sich mit einem Verehrer treffen wollte – ein Mädchen wie sie musste derer viele haben –, doch dann sah ich, dass sie den jungen Stutzern, die sie beäugten, eher auszuweichen schien, um sich der hohen Gesellschaft am Kamin zu nähern. Wahrscheinlich, sagte ich mir, wollte sie nur ihrer Herrin zur Seite eilen; aber Elizabeth wandte sich bei ihrem Herannahen einfach ab, als würde sie ihre eigene Gefährtin nicht wahrnehmen.
Auch wenn ich noch nicht lange am Hof war, konnte ich erkennen, wann jemand schauspielerte. Für mich sah es so aus, als belauschte das Mädchen Personen von höherem Rang, und Elizabeth, ihre Herrin, wäre sich dessen durchaus bewusst. Als ob sie gespürt hätte, wie ich sie anstarrte, sah das Mädchen plötzlich auf und begegnete meinem Blick. In ihren Augen las ich Trotz, Arroganz – und eine unverblümte Herausforderung.
Ich lächelte. Auch wenn man ihre Anziehungskraft einmal außer Acht ließ, bot sie mir die perfekte Lösung für mein Dilemma. Sie hatte mich mit Elizabeth sprechen sehen; sie musste erraten haben, dass ich mich bemühte, ihr eine geheime Botschaft zu übermitteln, die sie unter anderen Umständen eventuell gar nicht abgeneigt wäre zu akzeptieren. Gewiss würde eine so vertraute Dienerin die verborgenen Wünsche ihrer Herrin zu erfüllen suchen?
Plötzlich durchfuhr mich der Impuls zu handeln, meinen Teil des Geschäfts endlich zu erledigen, mich dann zu entschuldigen und zu Bett zu gehen. Ob ich je den Weg zurück zu den Gemächern der Dudleys finden würde, blieb abzuwarten; aber zumindest würde ich mich mit gutem Gewissen zur Ruhe begeben können, wenn ich getan hatte, was mir befohlen worden war. Und nach einer Mütze Schlaf würde ich auch in besserer Verfassung sein, meine zukünftige Rolle bei den Machtspielen der Dudleys zu überdenken.
Ich behielt das Mädchen im Auge, um den richtigen Moment für eine Annäherung nicht zu versäumen, und sah sie in einer Gruppe vorbeischlendernder Frauen verschwinden, nicht ohne mir über die Schulter ein Lächeln zuzuwerfen. Es war eine Einladung, die nur ein Narr ignoriert hätte.
Master Shelton schmunzelte. »Ein hübsches Weibsbild. Warum nicht anschauen, was sie zu bieten hat?« Er stieß mich in den Rücken. »Na, lauf. Falls Lord Robert kommt und nach dir fragt, werde ich sagen, ich hätte dich weggeschickt, weil ein Junker ohne seinen Herrn im Thronsaal nichts zu suchen hat.«
Ich war perplex. Täuschte ich mich, oder wollte er mich wirklich loswerden? Wie auch immer, das kam mir sehr recht. Mit einem erzwungenen Lächeln straffte ich die Schultern und schlenderte davon. Als ich mich umblickte, sah ich ihn schon wieder nach dem Weinkrug hinter sich greifen.
Ich folgte dem Mädchen in sicherem Abstand und bewunderte ihr üppiges, wie ein Banner den Rücken hinabfallendes Haar. Ich war, was Frauen betraf, nicht ganz unerfahren und fand sie weit verlockender als all die herausgeputzten und gepuderten Hofdamen. Doch ich war so intensiv mit ihrer Verfolgung beschäftigt, dass ich gar nicht auf die Idee kam, sie könnte etwas anderes im Sinn haben, als eine Begegnung zwischen uns herbeizuführen.
Unversehens machte sie einen Schritt zur Seite und verschwand in der Menge, als hätte sie sich in Luft aufgelöst. Ich spähte nach allen Seiten, konnte sie aber nirgends mehr entdecken.
Ich konnte es nicht fassen. So etwas hatte ich noch nie erlebt. Sie konnte doch nicht einfach davongeflogen sein.
Während ich nach ihr Ausschau hielt, wurde mir zu meinem Schreck bewusst, dass sie mich zum anderen Ende des Saals geleitet hatte, ganz in die Nähe des Königspodests, wo sich inmitten der noblen Gesellschaft auch die Prinzessin aufhielt.
Ich versuchte, mich kleinzumachen. Aus der Nähe betrachtet, war es eine einschüchternde Gruppe: privilegiert und glanzvoll, mit jener Ausstrahlung von unangreifbarer Überlegenheit, die den Adel vom Rest des Volkes unterschied. Elizabeth hatte Jane Grey verlassen und saß jetzt, mit verträumter, unaufmerksamer Miene lauschend, einer Person gegenüber, von der ich nur die beringte Hand am Knauf eines Gehstocks sehen konnte.
Vorsichtig wie eine Katze trat ich den Rückzug an, im Stillen betend, dass die Prinzessin mich nicht bemerken möge. Das hätte mir gerade noch gefehlt, dass sie mich vor allen anderen bloßstellte und meine weiß Gott zweifelhafte Zukunft vollends ruiniert wurde.
Nur noch darauf bedacht zurückzuweichen, wäre ich fast mit einer Dame zusammengestoßen, die aus der entgegengesetzten Richtung kam. Im letzten Moment bemerkte ich sie – und erstarrte vor Schreck.
Es war Lady Dudley, die Herzogin von Northumberland.
Ihr Anblick traf mich wie ein Schwall kaltes Wasser. Lady Dudley, Roberts Mutter. Konnte es noch schlimmer kommen? Warum nur musste ich ausgerechnet ihr über den Weg laufen? In ihrer Welt kannten die Lakaien immer ihren Platz. Und der meine war sicher nicht hier, im Thronsaal.
Sie wirkte wie aus Marmor gemeißelt, ihre strenge Schönheit noch hervorgehoben durch ein exquisites granatrotes Samtgewand. Ich stand da wie festgenagelt, schlagartig zurückversetzt zu dem Augenblick vor ein paar Jahren, als sie mich bei dem Versuch, ein Buch aus der Dudley-Bibliothek zu schmuggeln, ertappt hatte.
Ich war damals dreizehn Jahre alt gewesen und untröstlich über den plötzlichen Verlust von Mistress Alice. Bei dem Buch, das Alice sehr geliebt hatte, handelte es sich um eine Sammlung von Psalmen in französischer Sprache, in Kalbsleder gebunden, mit einer auf Französisch geschriebenen Widmung auf dem Deckblatt: A mon amie, de votre amie, Marie.
Lady Dudley hatte es mir aus der Hand genommen und mich in die Stallungen beordert. Eine Stunde später war Master Shelton mit der Peitsche gekommen. Er war erst knapp ein Jahr im Dienst der Dudleys; er kannte mich kaum und versetzte mir die strafenden Hiebe eher zögerlich, sodass sie mehr Demütigung als Pein bewirkten. Aber danach wagte ich mich erst wieder in die Nähe der Bibliothek, als Lady Dudley sich an den Hof begab. Und selbst nach ihrer Abreise dauerte es noch Wochen, bis die Bücher mich zurücklockten; und dann schlich ich mich nur noch des Nachts hinauf und stellte jedes Werk zurück, sobald ich es gelesen hatte, als ob sie meine Verstöße gegen die Regeln aus der Ferne ausspionieren könnte.

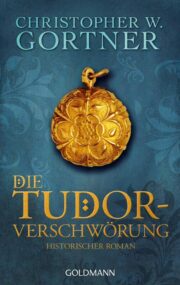
"Die Tudor-Verschwörung" отзывы
Отзывы читателей о книге "Die Tudor-Verschwörung". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Die Tudor-Verschwörung" друзьям в соцсетях.