«O Gott!»
«Jag sie raus, Ruth!»
«Ich glaube, sie wohnt hier. Janet hat irgend etwas von einer Katze gesagt.»
«Es ist doch egal, ob sie hier wohnt oder nicht.» Heini sprang auf, scheuchte die Katze hinaus und verriegelte die Tür.
«Wir hätten ihn töten sollen», sagte Ruth.
«Ohne Gewehr kann ich keine Katzen töten.»
«Doch nicht die Katze. Den Vogel!»
Mit einem leichten Gefühl von Übelkeit hob sie ihr Glas und trank. Sauer und kalt rann der Wein in ihren Magen. Es gab da bei Weinen anscheinend beachtliche Unterschiede ...
«Komm, Ruth! Gehen wir ins Schlafzimmer.»
«Ja, gleich, Heini. Ich möchte gern erst etwas in Stimmung kommen. Wollen wir nicht ein bißchen Musik machen?»
«Ich bin in Stimmung», sagte Heini unwirsch. Aber er folgte ihr ins Wohnzimmer, wo sich auf einem niedrigen Tisch ein Stapel Schallplatten türmte.
«Ach, schau!» sagte sie entzückt. «Sie haben Glanzlichter aus La Traviata.»
Aber wahre Musiker hören sich natürlich niemals Glanzlichter an – das kann man nicht erwarten –, und Heini machte ein ziemlich beleidigtes Gesicht.
«Du liebst mich doch?»
«Aber Heini, das weißt du doch!»
Er streckte ihr in einer jungenhaften, rührenden Geste beide Hände hin. Sie legte die ihren hinein. Sie gingen ins Schlafzimmer. Und er zog seine Socken aus – da mußte ihn jemand gewarnt haben. Es würde alles gut werden.
«Ach, verdammt! Diese Wohnung ist die reinste Müllkippe! Jetzt hab ich einen Reißnagel im Fuß.»
Er hatte sich aufs Bett fallen lassen und hielt mit beiden Händen seinen linken Fuß umklammert, aus dessen Sohle tatsächlich ein Tröpfchen Blut quoll.
«Na, wenigstens ist es nicht der Teil, mit dem du auf die Pedale trittst», sagte Ruth, die immer seine Gedanken lesen konnte. «Es ist rechts auf der Seite. Aber warte, ich hole ein Pflaster.»
«Und Jod», rief Heini ihr hinterher, als sie zur Tür lief. «Der Boden wimmelt bestimmt von Bakterien.»
Im Badezimmer fand sie ein Fläschchen Jod und eine Rolle Heftpflaster, aber keine Schere. Sie durchsuchte die Schubladen in der Küche, aber ohne Erfolg. Schließlich nahm sie ein Küchenmesser und versuchte damit, ein Stück Pflaster abzuschneiden.
«Es hat aufgehört zu bluten», rief Heini aus dem Schlafzimmer. «Es reicht, wenn du die Wunde desinfizierst.»
Sie nahm das Jod mit ins Schlafzimmer und rieb Heinis Fuß damit ein. Heini war tapfer, zuckte nicht einmal mit der Wimper. «Jetzt müssen wir warten, bis es trocken ist.»
«Das dauert nicht lang», sagte er. «Zieh dich doch inzwischen aus.»
«Ich bring nur erst das Jod zurück. Es wär doch zu peinlich, wenn wir es ausschütten würden.»
Sie ging an den Aktzeichnungen vorüber, trat auf eine kleine graue Feder, die von der Brust des kleinen Vogels herabgefallen war, und stellte die Jodflasche wieder ins Schränkchen. Als sie zurückkam, sah sie, daß Heini schon im Bett war.
Es ließ sich also nicht mehr länger aufschieben – das Leben bis zur bitteren Neige. Ruth kreuzte die Arme und zog ihren Pullover über den Kopf.
Am selben Nachmittag, als Heini sich in Bloomsbury als dämonischer Liebhaber übte, fuhr Quin ins Naturhistorische Museum, um mit seinem Assistenten die bevorstehende Reise zu besprechen.
«Ich habe leider schlechte Nachricht für Sie», sagte Milner und kletterte von dem Gerüst herunter, auf dem er bis jetzt, mit den Halswirbeln eines Brontosaurus beschäftigt, gestanden hatte. Aber er lächelte dabei. Seit Quin ihm eröffnet hatte, daß sie im Juni abreisen würden, war er glänzender Stimmung.
«Was für schlechte Nachricht?» fragte Quin.
«Das sag ich Ihnen unter vier Augen», antwortete Milner geheimnisvoll und führte Quin in sein kleines Büro im Souterrain. «Es handelt sich um Brille-Lamartaine», fuhr er fort. «Er hat anscheinend von unserer geplanten Reise Wind bekommen und möchte mit. Seit Tagen lauert er mir auf, macht mir Andeutungen und geht mir ganz generell fürchterlich auf die Nerven. Ich habe ihm kein Wort gesagt, aber es scheint etwas durchgesickert zu sein.»
«Ach, du lieber Gott! Ich dachte, er sei in Brüssel.»
Brille-Lamartaine war der belgische Biologe, dessen Brille von einem Yak zertrampelt worden war. Es kommt selten vor, daß ein Mitglied einer Expedition die reine Katastrophe ist und nicht wenigstens ein paar Züge aufweist, die mit ihm versöhnen; BrilleLamartaine jedoch war ein solcher Fall.
«Wo er wohl davon gehört hat?»
«Er war viel bei der Geographischen Gesellschaft. Hillborough ist ja absolut diskret, aber vielleicht ist eben doch etwas durchgesikkert.»
«Passen Sie auf», sagte Quin, «Wenn er das Thema wieder aufs Tapet bringt, dann sagen Sie ihm, daß ich eine Frau mitnehme. Eine meiner Studentinnen. Eine junge, lebenshungrige Person, die für Männer eine große Schwäche hat.»
Milner lachte. Er wußte, daß Brille-Lamartaine vor Frauen eine Heidenangst hatte und überzeugt war, jede von ihnen habe es sowohl auf seinen rundlichen Körper als auch auf seine Erbschaft von einer unverheirateten Tante abgesehen.
«Mit Vergnügen», sagte er.
Quin jedoch war klar, als er das Museum verließ, daß er seinen Mitarbeitern seinen Entschluß zu gehen nicht länger verheimlichen durfte. Wenn er sich Plackest gegenüber an die gesetzliche Frist hielt und bis Ostern wartete, so reichte das, aber auf keinen Fall sollten Roger, Elke und Humphrey die Nachricht von anderen erfahren.
Roger Felton war im Labor, als er ins Fakultätsgebäude kam, nutzte das Wochenende, um liegengebliebene Arbeit zu erledigen. Der Ausdruck seines Gesichts, als Quin ihn einweihte, war kaum zu ertragen.
«Ohne Sie werde ich mir hier wie in der Wüste vorkommen», sagte er und wandte sich ab, um seine Bestürzung zu verbergen. «Elke dachte schon, daß so etwas passieren würde, aber ich hoffte–ach, so ein Mist!»
«Es ist Ihnen vielleicht kein Trost, aber ich fürchte, schon im nächsten Jahr werden wir alle in sämtliche Winde verstreut sein», sagte Quin. «Wenn dieser Krieg wirklich kommt, dann wird er ganz anders werden als der letzte. Ich glaube, dann werden auch wir Wissenschaftler an die Front müssen.» Als Roger auch darauf nichts sagte, legte ihm Quin die Hand auf den Arm und fügte hinzu: «Ich nehme Sie mit nach Afrika, Roger, wenn Sie hier wegkönnen. Es wäre mir eine Freude.»
«Danke – Sie wissen, wie gern ich mitkäme, aber ich kann Lillian nicht allein lassen. Ende Mai werden wir ein Adoptivkind übernehmen, einen Säugling, das Kind einer kanadischen Tänzerin. Lillian ist unheimlich aufgeregt.»
«Das freut mich», sagte Quin mit Wärme. «Und falls Sie einen Paten brauchen, dann denken Sie vielleicht an mich.»
Rogers Gesicht hellte sich auf. «Sie haben den Job, Professor.»
Als Quin nach diesem Gespräch mit Roger durch den Hof ging, begegnete er Verena in Begleitung von Kenneth Easton. Sie hatte einen Squashschläger in der Hand und war offensichtlich bester Stimmung.
«Sie sehen sehr fit aus», sagte Quin, als er merkte, daß sie ihn nicht einfach vorübergehen lassen würde.
«Oh, das bin ich auch, Professor!» erwiderte Verena mit einem spitzbübischen Lächeln. Sie forderte ihn nicht gerade auf, ihren Bizeps zu fühlen, aber das war auch nicht nötig. Dank ihrem Sportdreß, kurzärmlige Bluse und Shorts konnte jeder, der Augen im Kopf hatte, den kernigen Zustand ihrer Muskeln sehen. Dann sagte sie: «Ach, was halten Sie eigentlich von dem Armee- und Marine-Ausstattungsgeschäft? Würden Sie es empfehlen, wenn man eine Expedition plant?»
«Absolut. Das Geschäft ist ausgezeichnet sortiert – ich decke mich immer dort ein; Sie bekommen alles, was Sie brauchen. Beziehen Sie sich bei Mr. Collins auf mich, dann werden Sie gut bedient.»
«Danke, das werde ich tun. Und wie ist es mit Flohpuder? Würden Sie da Coopers oder Smythsons empfehlen?»
Quin, der eine vage Vorstellung hatte, Verena plane eine längere Reise mit ihren Verwandten, plädierte für Coopers, ehe er sich höflich verabschiedete und weiterging. Kenneth war schlagartig in ein Loch tiefster Depression gestürzt. Die Opfer, die er für Verena gebracht hatte, waren erheblich. Er fuhr vierzehn Haltestellen mit der Untergrundbahn, um mit ihr zusammen Squash spielen zu können; er hatte sich unter großen Mühen seinen Cockney-Akzent abgewöhnt; er sagte «Pardon», weil «Entschuldigung» angeblich gewöhnlich war. Aber jedesmal, wenn der Professor auftauchte, schmolz Verena dahin und kokettierte wie ein Schulmädchen. Manchmal fragte sich Kenneth, ob das alles die ganze Sache wert war.
«Ich ziehe aus», verkündete Heini. «Ich suche mir ein anderes Zimmer.»
Leonie starrte den Jungen entgeistert an, der mit wild abstehenden Haaren und in grenzenloser Wut von seinem Samstagnachmittag in der Stadt zurückgekehrt war.
«Aber warum denn, Heini? Was ist passiert?»
«Ich kann nicht darüber sprechen, aber ich muß weg. Ich kann hier nicht bleiben. Ich kann ja nicht einmal spielen.»
Das stimmte nicht ganz. Heini war seit einer halben Stunde schon zu Hause und hatte die Lebenserwartung des gemieteten Klaviers um ein beträchtliches gemindert, indem er durch die Busoni-Variationen hindurchgedonnert war, daß die Teller in der Kredenz klapperten.
«Weiß Ruth das schon?» fragte Leonie nervös.
«Nein, noch nicht. Aber es wird sie nicht wundern», versetzte Heini finster.
«Du meine Güte! Wenn ihr gestritten habt ... ich meine, so was kommt doch mal vor.»
«Nein, so etwas nicht», entgegnete Heini rätselhaft. «So etwas kommt nicht vor. Ich ziehe aus, sobald ich etwas anderes gefunden habe.»
Leonie war in einem Widerstreit der Gefühle. Ruth würde niedergeschmettert sein, wenn sie von Heinis Entschluß hörte, und Leonie hätte alles getan, um ihrer Tochter Schmerz zu ersparen. Gleichzeitig jedoch hatte der Gedanke, daß Heini ausziehen würde, etwas Paradiesisches. Im Wohnzimmer wieder schalten und walten zu können, wie sie wollte, sich mittags ein Stündchen aufs Sofa legen zu können ... ins Bad hineinzukönnen, wann man wollte!

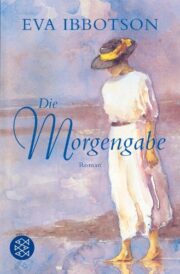
"Die Morgengabe" отзывы
Отзывы читателей о книге "Die Morgengabe". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Die Morgengabe" друзьям в соцсетях.