Heini verspürte nicht ein Fünkchen der Euphorie, die diese Nachricht bei den anderen auslöste. Ausgeschlossen, daß er sich zur Landarbeit meldete oder zu den Pionieren ging. Kein Mensch schien zu begreifen, daß die Musik nicht einfach irgendein selbstsüchtiger Zeitvertreib war; sie war seine Mission. Aber dafür hatten auch die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen kein Verständnis, die mit nervtötender Langsamkeit seine persönlichen Daten aufnahmen. Es dauerte zwei Tage, ehe er Leonie Berger anrufen durfte, aber die Verbindung war so schlecht, daß er sie kaum hören konnte; auch neigte er dazu zu vergessen, daß diese Familie, der einst alle Türen in Wien offengestanden hatten, jetzt mittellos und staatenlos war wie er selbst. Die Bergers konnten nicht für ihn bürgen; ihr Name hatte bei der Bürokratie kein Gewicht. Sie konnten jedoch versuchen, jemanden zu finden, der die Bürgschaft für ihn übernehmen würde; sie wollten ihm helfen. Und Ruth würde kommen. All seine Hoffnung konzentrierte sich auf sie, als er die Hände in den Kübel mit dem kalten Wasser tauchte und die nächste Kartoffel herausholte.
Am späten Nachmittag, als sie aus Emailbechern ihren Tee tranken und dazu die trockenen Biskuits aßen, die ausgeteilt worden waren, erschien ein junger Mann von der Verwaltung an der Tür der Baracke.
«Mr. Radek?» rief er.
Heini stand mit klopfendem Herzen auf.
«Sie haben Besuch. Im Büro.»
«Wer ...?» stammelte Heini.
«Ein Mädchen», sagte der Bote. «Eine Klassefrau.» Er sah Heini mit neuem Respekt an.
Ruth stand ruhig da und wartete. Sie war seit der vergangenen Nacht unterwegs und hatte kaum etwas gegessen, aber sie brauchte auch nichts, so froh und glücklich war sie. Auf der ganzen Fahrt von Northumberland nach Süden hatte sie voller Angst und Verzweiflung gebetet, versprochen, alles hinzugeben, was ihr lieb und teuer war, wenn er nur in Sicherheit wäre. Und dann war das Wunder geschehen: Ihre Mutter hatte ihr erklärt, daß Heini hier war, daß sie falsch verstanden hatte, daß das Lager in England war und sie zu ihm fahren konnte.
Als Heini eintrat, raubte ihr sein Anblick die Stimme. Das war nicht das begnadete Wunderkind, das sie gekannt hatte; dies war ein verängstigter, verwahrlost aussehender junger Mann, unrasiert, die Hoffnungslosigkeit des Besiegten in den Augen. Von Liebe und Mitleid überwältigt, breitete sie die Arme aus, und er flüchtete sich zu ihr.
«Gott sei Dank, Ruth! Ich dachte schon, du würdest nie kommen.»
«Ach, mein Liebster. Du bist wirklich hier. Du bist es wirklich.» Ihre Stimme brach. «Ich dachte, du wärst in einem richtigen Lager, weißt du. Ich dachte, sie hätten dich geschnappt.»
«Das hier ist ein richtiges Lager. Es ist grauenvoll, Ruth.»
«Ja – ja – aber verstehst du nicht, ich dachte, du wärst in Dachau oder Oranienburg. Meine Mutter hat mich angerufen, und ich konnte sie nicht richtig hören. Als ich dann erfuhr, daß du in Sicherheit bist ... ich werde das mein Leben lang nicht vergessen.»
Und sie würde auch ihr Leben lang nicht vergessen, was sie gelobt hatte: Heini bis zum letzten Atemzug zu dienen und ewige Abbitte zu leisten für jene Zeit des Verrats, als sie nicht an ihn gedacht, sondern nur ihr Glück am Meer genossen hatte.
«Du nimmst mich doch mit nach Hause, nicht wahr, Ruth? Jetzt gleich?»
«Heini, jetzt gleich geht das nicht. Ich muß erst Dr. Friedlander erreichen – ich bin ganz sicher, er wird für dich bürgen, aber er ist übers Wochenende weggefahren. Gleich morgen in aller Frühe gehe ich zu ihm, und dann dauert es nur noch ein paar Tage.»
«Ein paar Tage!» Heini hob den Kopf. «Ruth, so lange kann ich hier nicht bleiben. Ich kann einfach nicht.»
«Ach, bitte, Heini, Liebster! Wir tun alles für dich – und die Leute sind doch nett hier, oder nicht? Ich hab mit der Sekretärin gesprochen.»
«Nett!» Aber allein ihre Anwesenheit war so tröstlich, daß er beschloß, tapfer zu sein, und es gelang ihm sogar, das Thema zu wechseln. «Hast du ein Klavier besorgen können?» fragte er.
«Ja. Einen Bösendorfer.»
«Einen Flügel?»
«Nein, wir haben ja nur so ein kleines Wohnzimmer, weißt du. Aber es ist sehr schön.»
Er war enttäuscht, aber er wollte ihr keine Vorwürfe machen. Sie war seine Retterin.
Sie hielten einander immer noch in den Armen, als die Sekretärin zurückkehrte. «Sie müssen jetzt zum Bus, Miss Berger», sagte sie. «Sie dürfen ihn nicht verpassen. Es ist der letzte.»
Als Ruth ihren Mantel nahm, sah sie einen Vogel, der draußen vor dem Fenster auf einem Zaunpfahl saß. «Ach, schau doch, Heini! Ein Star! Das ist ein Omen. Das bedeutet Glück.»
Sie zog ihn zum Fenster. Der Vogel neigte den Kopf zur Seite und sah mit glitzernden Augen zu ihnen herüber, aber sein Hinterteil sah etwas mitgenommen aus.
«Er hat ein paar Schwanzfedern verloren», bemerkte die Sekretärin. «Sieht aus, als wäre er abgestürzt.»
«Ja.» Ruth sah es auch, aber es war ohne Belang. Ein glückliches Omen war ein glückliches Omen.
22
Anfang Dezember beschloß Leonie Channukka zu feiern, das jüdische Fest des Lichts. Licht, fand sie, würde jetzt guttun. Kurt war immer noch in Manchester, und er fehlte ihr; die Nachrichten vom Kontinent wurden immer bedrückender, und das Wetter – feucht und neblig, nicht das klare, frische Winterwetter, das sie aus Wien in Erinnerung hatte – schlug einem aufs Gemüt.
Und dann noch Heini. Heini schlief seit einem Monat auf dem Sofa in ihrem Wohnzimmer und übte jeden Tag acht Stunden auf dem Klavier. Leonie sah natürlich ein, daß das sein mußte, aber während sie mit dem Staubtuch um ihn herumschlich, ertappte sie sich dabei, daß sie sich über die Freunde und Verwandten früherer Klaviervirtuosen Gedanken machte. Gab es vielleicht irgendwo in einer Mansarde in Budapest eine alte Dame, deren Mutter einst schreiend auf die Straße hinausgestürzt war, weil sie sich von Liszts brillanten Arpeggios gefoltert fühlte? War es den Bewohnern des Hauses in der Rue de Rivoli gelungen, sich auf Chopins Übungsstunden einzustellen? Was hatten diese Wiener Zimmerwirtinnen damals wirklich empfunden, wenn Beethoven wieder einmal ein Klavier in Grund und Boden gespielt hatte?
Auch die Essensfrage spielte eine Rolle. Heini hatte aus Ungarn etwas Geld mitgebracht, aber das brauchte er, um seine Hände versichern zu lassen; auch das sah sie ein. Den Rest gab er für die öffentlichen Verkehrsmittel aus, wenn er seine Fahrten zu Agenten und Impresarios machte, von denen er hoffte, daß sie ihm helfen würden.
«Es ist für Ruth», pflegte Heini mit seinem süßen Lächeln zu sagen. «Alles, was ich tue, tue ich für Ruth.»
Und alle akzeptierten das. Heini hatte seine Absicht kundgetan, Ruth zu heiraten und ihr ein angenehmes Leben zu bereiten, sobald er sich etabliert hatte; man konnte also unmöglich an ihm herumkritisieren. Wenn er eine Stunde im Badezimmer verbrachte, so deshalb, weil er bei den geschäftlichen Besprechungen einen guten Eindruck machen mußte; wenn er seine Sachen herumwarf und Leonie hinter sich aufräumen ließ, so deshalb, weil er mit seiner Musik so beschäftigt war, daß für anderes keine Zeit blieb. Ohne Klage also paßten sich die Bewohner von Nummer 27 den neuen Umständen seiner Anwesenheit an.
Mishak war nicht musikalisch. Er liebte die Stille, die sanften Geräusche: den Gesang einer Drossel vor dem Fenster; das Rauschen des Regens; das Sirren einer Sense, wenn der Rasen gemäht wurde. Wenn Heini jetzt auf sein Klavier einhieb, war er von alledem abgeschnitten. Er machte es sich zur Gewohnheit, noch früher aufzustehen, und arbeitete im Garten, bis Heini aufstand, dann ging er auf lange Streifzüge. Aber die Tage wurden kürzer, Mishak war vierundsechzig, immer häufiger trieb es auch ihn, obwohl von Natur aus kein geselliger Mensch, ins Willow.
Paul Ziller hatte bei Heinis Ankunft gehofft, sie würden Duette spielen, denn für Geige und Klavier gibt es sehr vielfältige und sehr schöne Kompositionen. Doch Heini wollte sich verständlicherweise auf eine Solokarriere konzentrieren, und da die Schallisolierung des Hauses nicht solide genug war, um zwei übende Musiker zu verkraften, marschierte Ziller von nun an wieder täglich mit seiner Guarneri ins Jewish Day Center.
Auch Hilda änderte ihren Tageslauf. Der Kustos der anthropologischen Abteilung hatte ihr mittlerweile sogar einen Schlüssel anvertraut. Sie nahm sich Brote mit ins Museum und richtete es so ein, daß sie immer erst nach Hause kam, wenn Fräulein Lutzenholler auf ihren Schlafzimmerstuhl kletterte.
Daß sie der finsteren Psychoanalytikerin noch einmal dankbar sein würden, hätte keiner von ihnen ahnen können, aber so war es. Jeden Abend nämlich, punkt einundzwanzig Uhr dreißig, pflegte sie mit einem langen Besen bewaffnet auf einen Stuhl zu klettern und an die Decke ihres Schlafzimmers zu klopfen, über dem sich das Wohnzimmer der Bergers befand, um wissen zu lassen, daß sie nun zu Bett gehen würde und die Musik aufhören mußte.
Aber das bedeutete, daß Leonie sich nicht über den Zustand des Herds beklagen konnte; ein Fest des Lichts war also alles in allem dringend vonnöten, und da sie selbst nicht genau wußte, was der Brauch vorschrieb, trug sie ihr Problem ins Willow.
«Darf ich Sie zu einem Stück Kuchen einladen?» fragte Mrs. Weiss. Leonie nahm an und fragte die alte Dame um Rat.
«Auf jeden Fall braucht man Kerzen», erklärte Mrs. Weiss entschieden. «Das weiß ich. Man zündet acht Tage lang jeden Tag eine an, und man steckt sie in eine Menora.»
«Wie soll das gehen?» fragte Dr. Levy. «Wenn es acht Tage sind, müssen es acht Kerzen sein, und eine Menora hat nur sieben Arme. Gebete gehören übrigens auch dazu. Meine Großmutter hat immer gebetet.»

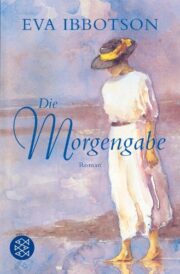
"Die Morgengabe" отзывы
Отзывы читателей о книге "Die Morgengabe". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Die Morgengabe" друзьям в соцсетях.