«Ja, er ist drüben hinter der Laube. Und bringen Sie gleich eine Gießkanne mit.»
Ruth verschwand. Minuten verstrichen. Dann ein Aufschrei. Unwillig und einen Moment lang erschrocken stand Frances auf.
Ruth kniete mitten in einem Flecken blaßvioletter Blumen, die im Gras hinter der Laube wuchsen. Sie kniete dort wie in tiefer Anbetung, und Frances, die neuerliche Emotionsausbrüche fürchtete, sagte scharf: «Was ist denn? Das sind Herbstzeitlosen, sonst nichts. Ich habe sie vor ein paar Jahren eingesetzt, und sie haben sich ausgebreitet.»
«Ja, ich weiß. Ich weiß, daß es Herbstzeitlosen sind.» Sie hob den Kopf und strich sich das Haar aus den Augen. Es war, wie Frances gefürchtet hatte; sie war dem Weinen nahe. «Wir haben jedes Jahr auf sie gewartet, bevor wir aus dem Gebirge nach Wien zurückgefahren sind. Oberhalb vom Grundlsee waren ganze Wiesen voller Herbstzeitlosen ... Sie hatten eine besondere Bedeutung für uns – Hochsommer, aber auch, daß es Zeit war, wieder Abschied zu nehmen. Ich hätte nie gedacht, daß ich sie hier am Meer finden würde. Ach, wenn Onkel Mishak doch hier wäre. Wenn er sie nur sehen könnte.»
Sie stand auf, aber es fiel ihr schwer, den Griff des Schubkarrens zu fassen und den Blumen den Rücken zu kehren.
«Wer ist Onkel Mishak?»
«Mein Großonkel – Gartenarbeit ist das Schönste für ihn. Er hat es sogar geschafft, in Belsize Park einen Garten anzulegen, und das ist wirklich nicht einfach.»
«Das kann ich mir vorstellen. Eine schreckliche Gegend.»
«Ja, aber die Leute sind nett. Er hat hinter dem Haus gejätet und umgegraben, und jetzt versucht er, für meine Mutter Gemüse zu ziehen. Wir bekommen zwar keinen Dünger, aber ...»
«Wieso nicht? Den gibt es doch bestimmt überall zu kaufen.»
«Ja, aber wir können ihn uns nicht leisten. Aber das macht nichts – wir nehmen einfach die Küchenabfälle und so. Ach, wenn er die Herbstzeitlosen sehen könnte! Das waren Mariannes Lieblingsblumen. Sie ist gestorben, als ich sechs war, aber ich weiß noch, wie sie immer auf der Wiese über dem Grundlsee stand und nur schaute. Wir anderen sind herumgerannt und haben geschrien, wie schön sie sind, aber Marianne und Mishak haben nur dagestanden und geschaut.»
«Sie war seine Frau?» fragte Frances, der klar war, daß sie informiert werden würde, ob sie es wollte oder nicht.
«Ja. Er hat sie über alles geliebt. Es ist ihm sehr schwergefallen, aus Wien wegzugehen, weil dort ihr Grab ist. Er ist jetzt alt, aber das hilft auch nichts.»
«Wieso sollte es?» fragte Frances kurz und fügte beinahe wider Willen hinzu: «Wie alt?»
«Vierundsechzig», antwortete Ruth, und Frances runzelte wieder die Stirn. Für eine Frau von sechzig ist vierundsechzig nicht alt.
Ruth warf der ehrfurchtgebietenden Herrin des Gartens einen Blick zu und traf eine Entscheidung. Man mußte es verdienen, die Geschichte von Mishak und Marianne zu hören, aber merkwürdigerweise erschien ihr diese Frau mit dem bitterscharfen Wesen, die Quin in Ruhe gelassen hatte, wert, die Geschichte zu hören.
«Möchten Sie hören, wie sie sich kennengelernt haben, Onkel Mishak und Marianne?»
«Meinetwegen», antwortete Frances.
«Also, das war so», begann Ruth, während sie Kompost in die für die Blumenzwiebeln vorbereiteten Löcher gab. «Eines Tages vor vielen, vielen Jahren, als der Kaiser noch auf dem Thron saß, war mein Onkel Mishak an der Donau beim Angeln. Aber an dem Tag fing er keinen Fisch, sondern eine Flasche.»
Sie machte eine Pause, um zu prüfen, ob sie recht gehabt hatte, ob Frances Somerville es wirklich wert war, die Geschichte zu hören. Ja, sie war es.
«Und weiter», sagte Frances.
«Es war eine Limonadenflasche», fuhr Ruth fort. «Und in der Flasche war ein Brief ...»
Spät am Abend dieses Tages stand Frances an ihrem Schlafzimmerfenster und sah aufs Meer hinaus. Es hatte geregnet, an den Bäumen glitzerten noch Wassertropfen, aber der Himmel war wieder klar, und der Mond schien auf das stille Wasser.
Doch die Schönheit der Natur hatte kaum eine Wirkung auf Frances. Sie fühlte sich unruhig und verwirrt. Es hätte alles ganz einfach sein sollen: Verena Plackett, so passend und standesgemäß, würde Quin heiraten. Bowmont würde gerettet werden, und sie würde, wie geplant, in das alte Pfarrhaus im Dorf ziehen und dort mit Martha und ihren Hunden in Frieden leben.
Statt dessen ertappte sie sich jetzt dabei, daß sie über eine Frau nachdachte, die sie nie gekannt hatte, ein reizloses Wesen, das vor vielen, vielen Jahren voll Angst und Scham vor einer Klasse respektloser Kinder in einem österreichischen Dorf gestanden hatte. «Sie war dünn wie eine Bohnenstange», hatte das junge Mädchen im Garten gesagt, «und sie hatte eine große Nase und hat ein bißchen gestottert. Aber für ihn war sie alles.»
Frances war gerade zwanzig Jahre alt gewesen, als sie, in dem Glauben, aus freien Stücken erwählt worden zu sein, zu ihrem Verlobten an der schottischen Grenze gereist war. Sie wußte, daß sie nicht hübsch war, aber sie meinte, eine gute Figur zu haben, und sie war eine Somerville – sie glaubte, das zählte. Das Haus war wunderschön, in einem Tal der Tweedsmuir Hills gelegen. Der junge Mann hatte ihr gefallen; während sie sich an jenem ersten Abend zum Essen ankleidete, stellte sie sich ihre Zukunft vor – als Braut, als Ehefrau, als Mutter ...
Es war spät, als sie in ihr Zimmer zurückkehrte, wo Martha sie erwartete, um ihr beim Auskleiden zu helfen. Sie hatte wohl die Tür offengelassen, denn sie konnte Stimmen aus dem Korridor hören.
«Guter Gott, Harry, du willst doch diesen Ameisenbär nicht im Ernst heiraten?» Eine junge Stimme, hochmütig, spöttisch. Ein alberner Junge, ein Freund ihres Verlobten, der am Abendessen teilgenommen hatte.
«Du wirst Hafer an sie verfüttern müssen – hast du das Gebiß gesehen?» Eine zweite Stimme, noch ein Freund.
«Die reißt dich in Stücke.»
Und dann die Stimme ihres Verlobten, der in den Spaß einstimmte. «Keine Angst, ich habe mir alles genau überlegt. Einmal im Monat besuche ich sie in ihrem Zimmer, in meiner Fechtausrüstung, das ist Polsterung genug. Und sobald sie schwanger ist, verschwinde ich in die Stadt und suche mir was Schnuckeliges.»
Martha war es, die die Tür schloß. Sie half ihr ins Bett und hielt den Mund, als Frances am folgenden Morgen ohne ein Wort abreiste. Sie hielt auch den Mund, als Frances schweigend den Zorn ihrer Familie und die Empörung der anderen Familie über sich ergehen ließ. Das war nun vierzig Jahre her, und seitdem war nichts geschehen. Keine Tür hatte sich für Frances Somerville geöffnet. Kein schwarzgekleideter kleiner Mann war erschienen, um sie zu erlösen.
Irritiert und innerlich aufgewühlt, wandte sich Frances vom Fenster ab, und in diesem Moment kam Martha mit der abendlichen heißen Schokolade herein – hinter ihr das häßliche kleine Hündchen.
«Was hat das denn zu bedeuten?» rief sie, froh, etwas gefunden zu haben, worüber sie ärgerlich sein konnte. «Ich dachte, du wolltest ihn nach dem Tee ins Black Bull hinunterbringen.»
«Mrs. Harper hat ausrichten lassen, daß sie ihn nicht nehmen kann», erklärte Martha. «Ihre Schwiegermutter zieht jetzt für immer zu ihnen, und sie kann Hunde nicht ausstehen.» Sie sah zu dem Hündchen hinunter, das sich zu Frances' Füßen auf den Rücken geworfen hatte. «Er möchte gestreichelt werden.»
«Das sehe ich», sagte Frances und hob es hoch. Nichts hatte sich geändert, weder an der Häßlichkeit des Hündchens noch an seiner tiefen Überzeugung, von Herzen geliebt zu werden.
So weit war es also schon gekommen, dachte sie. Vor zwanzig Jahren hätte sich die Frau eines Gastwirts geehrt gefühlt, wenn die Herrschaft aus dem großen Haus ihr einen Hund geschenkt hätte. Ganz gleich, was für einen. Er paßte genau ins Bild, dieser häßliche kleine Mischling ... er paßte zu jüdischen Kellnerinnen, die beim Anblick von Herbstzeitlosen in Tränen ausbrachen; zu Stallknechten, die Opernarien schmetterten; zu Wagners Stieftochter mit den ungleichen Augen. Comely schlief immer in ihrem Zwinger; es wäre ihr nicht eingefallen, nach oben zu laufen.
«Ich bringe ihn hinunter», sagte Martha und streckte die Arme nach dem Hündchen aus.
«Ach, laß ihn noch ein bißchen hier», entgegnete Frances müde. Mit dem Hündchen im Arm setzte sie sich in den Sessel neben ihrem Bett.
«Ich bin gekommen, um Sie zu holen», hatte der kleine Mann gesagt. Dann hatte er seinen Hut gelüftet und seine Aktentasche geöffnet ...
Die Fahrt zu den Farne-Inseln begann so gut. Das Wetter war in den letzten zwei Tagen unbeständig gewesen, doch jetzt schien die Sonne wieder, und als die Peggoty aus dem Hafen tuckerte, verspürten alle diese Aufwallung freudiger Zuversicht, die jeden erfaßt, der an einem klaren Tag auf blauem Meer Kurs auf eine Insel nimmt.
Auch das Hündchen verspürte sie, das war deutlich zu sehen. Die Zurückweisung durch die Wirtsleute hatte kein Trauma bei ihm hinterlassen, und es war jetzt in seiner Rolle als Maskottchen der Studenten fest etabliert. In sein kleines Boot ließ Quin das Hündchen nicht hinein, aber die Peggoty war ein solider Fischkutter, auf dem es sogar eine Art Kabine gab, in der der Eigentümer, von dem Quin sie jedes Jahr mietete, sonst sein Gerät und seine Netze verstaute. Dort konnte man den Hund einsperren, wenn man an Land ging.
Roger Felton war nicht mitgekommen; er wollte die Funde vom vergangenen Tag sortieren. Quin war am Steuer, hielt auf eine der kleineren Inseln zu. Der Verwalter dort erwartete sie, um ihnen alles zu zeigen. Die spektakuläre Brutzeit im Frühjahr hatten sie verpaßt; da waren die Felsen weiß von nistenden Lummen und Tordalken. Jetzt waren andere Gäste da: Goldhähnchen und Feldlerchen und Ammern – und Robben, zu Hunderten, die jetzt zurückkehrten, um ihre Jungen zur Welt zu bringen.

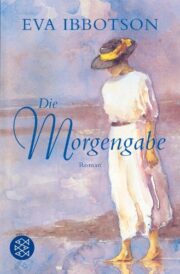
"Die Morgengabe" отзывы
Отзывы читателей о книге "Die Morgengabe". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Die Morgengabe" друзьям в соцсетях.