Roger Felton sah sich das Tier an, das sie von einem Felsbrocken abgezogen hatte, und stimmte zu, worauf Kenneth in einem Anfall spontaner Bewunderung rief: «Wirklich, Verena, bei den Zweischaligen bist du genial.»
Aber Verena war nicht nur bei den Zweischaligen genial. Die anderen Studenten waren schon froh, wenn sie eine Napfschnecke erkannten; Verena konnte ohne Mühe zwischen einer flachen Tellerschnecke und einer gegliederten Tellerschnecke unterschei den; sie kannte ein ganzes Arsenal von Wasserschnecken: darunter Sumpfschlammschnecken und Ohrschlammschnecken; sie wußte, daß es von dem tapferen immergrünen Felsblümchen, das an den höheren Felsen ein karges Leben fristete, eine glattblättrige und eine rauhblättrige Art gab.
In dieser Welt jedoch, die einen von aller Kleinlichkeit reinigte, ging Ruth nicht, wie sie das in London getan hätte, zu den Nachschlagewerken im Labor, um nach Muscheln zu suchen, die von noch ausgefallenerer Art waren, oder um einen Borstenwurm zu entdecken, der noch borstiger war als der, den Verena mit ihrer Schaufel aus dem Sand geholt hatte. Sie wollte nicht über Muscheln nachlesen, sie wollte die Schalen in ihrer Hand halten und ihre feine Zeichnung bewundern. Sie verspürte keinen Drang, sich hervorzutun, andere zu übertreffen; sie vergaß selbst ihre ausgeklügelten Manöver, Quin Somerville aus dem Weg zu gehen – und lief mit dem kostbarsten Fund, den sie an diesem ersten Morgen machte, zu ihm.
«Schauen Sie!» rief sie zum hundertsten Mal. «Schauen Sie, Smaragde!»
Er hielt ihr beide Hände hin, und sie schüttete die glatten grünen Steine in sie hinein.
«Könnten es wirklich Smaragde sein?» fragte sie. «Meine Großtante hatte ein Smaragdarmband, und die Steine sahen genauso aus.»
Er lachte sie nicht aus. Es gab Halbedelsteine an dieser Küste: Karneol, Achat, Amethyst. Sachte und behutsam holte er sie aus ihrem Traum zurück, indem er sagte: «Das kann nur das Meer – Steine zu solcher Glätte und Vollendung schleifen. Man könnte den besten Juwelier der Welt beauftragen und ihm ein ganzes Jahr Zeit geben, er würde dieser Vollkommenheit nicht einmal nahekommen.»
Er nahm einen der Steine und hielt ihn ans Licht, und als sie näher kam, um ihn zu betrachten, dachte er, wie gut Smaragde sich zu ihren dunklen Augen und dem lohfarbenen Haar ausnehmen würden.
Doch nun erschien Verena, die sich nie weit von Quin aufhielt, an ihrer Seite. «Du meine Güte, Ruth!» rief sie mit einem kurzen Blick aus zusammengekniffenen Augen. «Das sind doch bloß Flaschenscherben – das mußt du doch gesehen haben. Auch in Wien wird es wohl Flaschen geben.»
Sie sah Quin an, um mit ihm zusammen über Ruths Dummheit zu lachen – aber er hatte sich abgewandt und legte die Steine so sorgsam wieder in Ruths geöffnete Hände, als handelte es sich wirklich um kostbare Edelsteine.
«Flaschen können eine große Bedeutung haben», sagte er, ihr in die Augen sehend. «Das brauche ich Ihnen ja nicht zu sagen.»
Sie lächelte errötend und ging weg, glücklich darüber, daß er sich erinnerte, was sie ihm damals an der Donau erzählt hatte.
Um die Mittagszeit kam Verena zu Quin und sagte: «Sollten wir nicht zum Haus hinaufgehen? Soviel ich weiß, gibt es um ein Uhr Mittagessen.»
Sie bekam eine Abfuhr.
«Ja, ja, gehen Sie nur hinauf. Meine Tante legt Wert auf Pünktlichkeit. Ich bleibe hier unten – ich lasse das Mittagessen meistens ausfallen.»
Die Bemerkung löste bei Elke Sonderstrom beträchtliche Erheiterung aus; sie hatte mit Quins angeblicher Gewohnheit, das Mittagessen ausfallen zu lassen, ihre eigenen Erfahrungen gemacht. Jetzt holte sie sich zwei Mädchen als Hilfen und kehrte mit ihnen zum Bootshaus zurück, wo sie eine Kette Würstchen auspackte, die Pilly sogleich mit erstaunlichem Geschick in der Pfanne zu braten begann.
«Wieso hast du vor Würsten keine Angst?» fragte Janet, als Pilly die bruzzelnden, fettspeienden Dinger routiniert wendete. «Die sind doch viel gefährlicher als unsere Versuche.»
«Würstebraten muß ich nicht erst lernen», antwortete Pilly.
Aber am Nachmittag spielte sich Verena wieder in den Vordergrund. Quin fuhr jeweils mit einer Ladung Studenten in die Bucht hinaus, um ihnen zu zeigen, wie man nach Plankton dreggte, und Verena, die in Indien gesegelt war und bei der Regatta von Cowes der Crew ihres Vetters angehört hatte, war in ihrem Element. Sie brauchte nur einmal kurz an der Reißleine des Außenbordmotors zu ziehen, und schon sprang er knatternd an; sie wußte genau, wie man mit Segeln umging, sie ruderte wie eine Amazone, so daß es ganz natürlich war, daß sie an der Seite des Professors blieb, um zu helfen, während die anderen Studenten die Plätze wechselten.
Da sie sich ihrer Position so sicher war, konnte sie ihren Kommilitonen gegenüber um so großzügiger sein; sie half ihnen ins Boot und gab ihnen Tips, wie sie sich im Boot zu verhalten hatten, so daß Quin sich einzig darum zu kümmern brauchte, ihnen den richtigen Umgang mit den Netzen zu zeigen. Erst als Ruth ins Boot stieg und sich erbot, ein Ruder zu übernehmen, vergaß Verena ihre Hochherzigkeit.
«Kannst du überhaupt rudern?» fragte sie hochnäsig. «Ich kann mir nicht vorstellen, daß in Wien viel Wassersport getrieben wird.»
Ruth verkniff sich jedes Wort, obwohl Verena ein mörderisches Tempo vorlegte. Sie war ganz beseelt von einem neuen und noblen Entschluß, den sie noch am selben Abend ihren Freunden mitteilte.
«Ich habe beschlossen», verkündete sie, «Verena Plackett von jetzt an zu lieben.»
Die Studenten saßen am offenen Lagerfeuer und brieten Kartoffeln. Die dramatische Kulisse von Meer und Mondschein entsprach ganz Ruths erhabener Stimmung. Nur Kenneth Easton fehlte. Er hatte sich zurückgezogen; zu schwer war es ihm geworden, mitansehen zu müssen, wie Verena zum Abendessen mit dem Professor zum Haus hinaufgegangen war. Kenneth hatte in dem Spiegelscherben, den die Studenten zum Rasieren benutzten, eingehend sein Gesicht studiert und dabei festgestellt, wieviel regelmäßiger seine Gesichtszüge waren als die des Professors, wieviel gerader seine Nase. Und doch war klar, daß Verena den Professor bevorzugte. Allein jetzt und voller Melancholie blickte er zu den erleuchteten Fenstern von Bowmont hinauf und seufzte tief.
«Wirklich», beteuerte Ruth, als ihre Freunde sie ungläubig anstarrten. «Es ist mir ernst.»
«Du bist ja verrückt», stellte Janet fest und spießte eine weitere Kartoffel auf. «Total plemplem. Verena ist doch ein einziger Graus.»
«Ja, das weiß ich», bestätigte Ruth. «Darum hat es überhaupt keinen Sinn sich zu bemühen, sie zu mögen. Das hieße, das Unmögliche versuchen. Aber meine Eltern hatten in Wien einen Freund, einen alten Philosophen, der uns oft besuchte und der immer sagte: <Was man nicht mögen kann, das muß man lieben.>»
«Das versteh' ich nicht», bekannte Pilly bekümmert – und ein magerer Junge mit Brille sagte, ihm ginge es genauso.
«Na ja, es heißt, wenn man jemand nicht mögen kann, dann kann man ihn ganz tief drinnen dennoch lieben», erklärte Ruth. «Ja, je weniger man jemanden leiden mag, desto wichtiger ist es, daß man ihn liebt. Man muß ihn lieben, als wäre er der eigene Bruder oder die eigene Schwester – als Geschöpf dieser Welt eben. Als Mitsünder.» In ihrer Aufregung ließ Ruth ihre Kartoffel in den Sand fallen.
Sam sagte, obwohl er wußte, daß eine solche Bemerkung zu einem edlen Ritter nicht paßte, sie quassle Unsinn, und Janet erklärte, Sünder seien im Vergleich zu Verena die reinsten Kuscheltiere. «Sünder sind wenigstens menschlich», stellte sie fest.
Nichts jedoch konnte Ruth von ihrem noblen Entschluß abbringen, und sie zitierte zur Bekräftigung noch einen weisen Europäer, Dr. Freud nämlich, der gesagt hatte, liebenswert könne eine Sache erst werden, wenn sie geliebt werde. «Ihr werdet schon sehen», sagte sie. «Ich fange gleich morgen an, wenn wir nach Howcroft fahren. Den ganzen Tag werde ich sie lieben.»
«Barker hat ihn also genommen?» fragte Frances Somerville am nächsten Morgen, als sie der eben aus dem Dorf zurückkehrenden Martha begegnete. «Er ist einverstanden, ja?»
Das Hündchen war noch vor dem Frühstück zum Dorfzimmermann gebracht worden. Doch jetzt schüttelte Martha den Kopf. «Nein, er hat ihn nicht genommen. Er will ihn nicht haben.»
«Wie bitte? Er will ihn nicht haben?» Frances war fassungslos. «Hast du ihn darauf hingewiesen, daß er mit seiner Arbeit an den Kirchenstühlen zwei Monate im Rückstand ist?»
«O ja. Er hat gesagt, daß seine Frau Asthma hat, außerdem erwartet sie ein Kind, und der Arzt hat gesagt, keine behaarten Tiere!»
«Ich muß sagen, ich finde das sehr sonderbar. Früher hätten solche Leute von Asthma nicht einmal gehört gehabt. Man muß sich wirklich fragen, ob die allgemeine Schulbildung so vorteilhaft ist.» Sie bückte sich nach ihrer kleinen Gartenschaufel. «Und wo ist er jetzt?»
«Er hat mir angeboten, ihn zu erschießen», berichtete Martha. «Er hat gesagt, er würde überhaupt nichts spüren. Vorstellen kann ich's mir; er hat ja in seiner Jugend genug gewildert, Barker, meine ich. Der könnte einen Hasen auf fünfzig Meter schießen.»
Frances richtete sich auf. Ihr Gesicht war ausdruckslos. «Und du hast zugestimmt? Er hat ihn erschossen?»
«Nein», entgegnete Martha kurz und sah, wie die Hand ihrer Herrin, die die Schaufel hielt, sich entspannte. «Wenn man die Jungen gleich nach der Geburt, noch ehe sie die Augen aufgemacht haben, ertränkt, ist das vielleicht in Ordnung; aber sie kaltblütig erschießen – das ist was ganz anderes. Wenn Sie den Hund erschießen lassen wollen, müssen Sie den Befehl schon selber geben.»
«Wo ist er denn jetzt?»
«Eine von den Studentinnen hat ihn mitgenommen. Ich hab sie getroffen, als sie raufkam, um die Milch zu holen. Sie hat gesagt, sie behält ihn bei sich. Die ganze Korona fährt heute nach Howcroft, und ich hab mir gedacht, da Lady Plackett das Hündchen sowieso nicht besonders mag und außerdem Besuch kommt, ist das eine gute Lösung.»

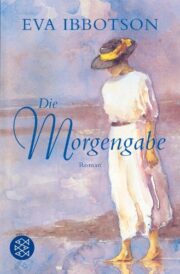
"Die Morgengabe" отзывы
Отзывы читателей о книге "Die Morgengabe". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Die Morgengabe" друзьям в соцсетях.