«O'Malley sagte, er hätte keine freien Plätze mehr.» Mit diesem Satz gab Quin Roger Felton seine Entscheidung bekannt. «Sagen Sie Miss Berger, sie kann bleiben.»
Roger nickte nur, verriet weder jetzt noch später auch nur mit einem Wort, was er soeben in den University News gelesen hatte: daß O'Malley nach einem Autounfall mit einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus lag und gar nicht in der Lage war, irgend etwas zu sagen.
15
In der zweiten Oktoberwoche wurden Leonies Gebete bezüglich der Kindergärtnerin erhört. Miss Bates verlobte sich – ein Triumph französischer Hemdhöschen über persönliche Ausstrahlung – und kehrte in das Haus ihrer Eltern in Kettering zurück, um ihre Aussteuer zu nähen. Ihr Zimmer im Erdgeschoß hinten wurde frei, und Paul Ziller zog ein, was alle sehr freute. Ziller brauchte jetzt nicht mehr in der Garderobe des Jewish Day Center zu üben, sondern konnte zu Hause bleiben; Leonie konnte sich seine Hemden zum Bügeln holen, wann immer es ihr paßte; und Onkel Mishak hatte direkten Zugang zum Garten.
Mishak hatte es nicht für nötig gehalten, das Stückchen Land zurückzugeben, das er zur Zeit der Krise von München für sich beschlagnahmt hatte. Man hatte ihm befohlen, Ruhe zu bewahren und zu graben, und das tat er weiterhin. Da er kein Geld hatte, um Pflanzen und Düngemittel zu kaufen, war er in seinen Möglichkeiten beschränkt, aber auch wieder nicht so beschränkt, wie man vielleicht vermutet hätte. Die alte Dame zwei Türen weiter war noch Eigentümerin ihres Hauses, und als Dank für seine Hilfe bei der Gartenarbeit schenkte sie Mishak Samen und Stecklinge aus ihrem Kräutergärtchen. Und auch Mishaks Streifzüge durch die Londoner Parks blieben nicht fruchtlos; er hatte stets sein Schweizer Armeemesser bei sich und eine Anzahl brauner Papiertüten. Es wäre ihm nicht eingefallen, den Pflanzen, denen er unterwegs begegnete, Schaden zuzufügen, aber diskretes und einfühlsames Stutzen hier und dort verhalf ihm zu manch hübschem Setzling, sei es von Jasmin oder Geranien oder anderen blühenden Pflanzen. Und wenn das Geld für Dünger nicht reichte, so bediente man sich eben des Komposts, von dem es in Nummer 27 in Hülle und Fülle gab,, angefangen mit den Resten von Fräulein Lutzenhollers Gemüsesuppen.
Hilda hatte mittlerweile im Britischen Museum den Durchbruch geschafft: Sie hatte sich ein Herz gefaßt und war ins Allerheiligste des Verwalters der anthropologischen Sammlung vorgestoßen, um ihm ihre Ansichten über den Trinkbecher der Mi-Mi kundzutun.
«Er ist nicht von den Mi-Mi», sagte sie, mit ernsthaftem Blick durch ihre Brillengläser spähend, und belegte ihre Behauptung.
Der Kustos hatte ihr nicht zugestimmt, aber er hatte sie auch nicht hinausgeworfen. Wer glaubte, Flüchtlinge dürften nicht arbeiten, befand sich im Irrtum. Kein Mensch hatte etwas dagegen, daß sie arbeiteten, sie durften nur kein Geld für ihre Arbeit nehmen. Nachdem Hilda sich als gelehrte Frau vom Fach ausgewiesen hatte, durfte sie selige Stunden im verstaubten Keller des Museums damit zubringen, die Objekte und Kunstwerke zu sortieren, die unternehmungslustige Weltenbummler im vergangenen Jahrhundert von ihren Reisen mitgebracht hatten.
Ein Hauch vorsichtiger Hoffnung durchwehte also im Oktober das Haus Nummer 27, um so mehr als Ruth, nunmehr ihres Studienplatzes in Thameside sicher, offensichtlich ihre Arbeit liebte. Selbst das finstere Fräulein Lutzenholler hatte jetzt eine neue Beschäftigung: Professor Freud hatte endlich Wien verlassen und sich in einem Haus nur wenige Straßen entfernt etabliert. Sie erwartete zwar nicht, von Freud bemerkt zu werden – der sowieso sehr alt und schwerkrank war –, da sie auf einer Tagung der Psychoanalytischen Gesellschaft im Jahr 1921 Freuds großen Rivalen, Jung, gelobt hatte; aber sie stellte sich gern einfach vor sein Haus und schaute es an, so wie Cézanne die Montagne Ste Victoire angeschaut hatte.
Da Hilda und die Psychoanalytikerin somit aus dem Weg waren, konnte Leonie nun ungehindert ihre Hausarbeit verrichten. Doch als es draußen kälter wurde, machte sie eine schreckliche Entdekkung. Ihr Entsetzen darüber teilte sie, obwohl sie sich in Grund und Boden schämte, mit Miss Violet und Miss Maud.
«Ich habe Mäuse im Haus», sagte sie mit umflorten Augen, denn der Befund schmerzte heftig.
Tatsächlich, mit dem Fortschreiten des Herbsts fielen die Mäuse in Scharen im Haus ein. Sie führten ein temperamentvolles Leben hinter den Sockelleisten von Nummer 27 und quietschten in der Ekstase der Kopulation hinter der Holztäfelung. Leonie deckte alles Eßbare zu, sie schrubbte, sie lauerte, sie schlug mit dem Besen, sie kaufte Gift – und die Mäuse wuchsen und gediehen.
«Haben Sie es mit Fallen versucht?» fragte Miss Maud. «Wir könnten Ihnen welche leihen.»
Aber für Fallen brauchte man Käse, und Käse war sündteuer.
«Dieser Hauswirt!» beschwerte sich Leonie, während sie ihren Kaffee umrührte. «Ich habe ihm immer wieder gesagt, daß er die Mäusefänger holen soll, aber er tut nichts.»
Miss Maud bot ihr eine ihrer jungen Katzen an, aber dieses Angebot schlug Leonie sehr höflich aus. «Ob ich mit Mäusen lebe oder mit Katzen – das ist für mich das gleiche», sagte sie traurig.
Auch Ruth waren die Mäuse nicht geheuer. Sie glaubte zwar nicht, daß sie die Keksdose mit dem Bild der Prinzessinnen auf dem Deckel durchnagen konnten, aber im Zuge von Mr. Proudfoots Bemühungen in ihrer Sache hatten sich mit der Zeit unter den Bodendielen viele wichtige Papiere angesammelt, und die Vorstellung, daß sie in Gefahr waren, von Mäusen gefressen zu werden, war ziemlich irritierend.
Allzuviel jedoch dachte sie nicht darüber nach. Das Leben an der Universität beschäftigte sie viel zu sehr. Hätte sie sich um Heini ängstigen müssen, so hätte sie sich ihrem Studium nicht mit solcher Hingabe widmen können, aber was Heini schrieb, war beruhigend: Sein Vater wußte jetzt genau, wen man schmieren mußte, und Heini rechnete fest damit, Anfang November bei ihr zu sein. Wenn Heini sich überhaupt Sorgen machte, so wegen des Klaviers, aber auch in diesem Bereich entwickelte sich alles gut. Ruth arbeitete nämlich immer noch drei Abende die Woche im Willow, und nun begann das Tea-Room auch Einheimische anzuziehen, die oben auf dem Hügel wohnten. Von den Flüchtlingen hätte sie niemals Trinkgeld genommen, selbst wenn sie es sich hätten leisten können; jedoch von den wohlhabenden Filmproduzenten und jungen Männern in schnittigen Autos, die «Atmosphäre» suchten, nahm sie, was sie bekommen konnte, und das Marmeladenglas war schon zu drei Vierteln gefüllt.
Auf die Nachricht von ihrer «Begnadigung» hatte Ruth damit reagiert, daß sie Quin um ein Gespräch unter vier Augen bat. Sie müsse ihm dringend etwas sagen, hatte sie erklärt.
In dem Bemühen, sich einen Treffpunkt einfallen zu lassen, wo er nicht Gefahr lief, Bekannten zu begegnen, war Quin auf das Tea Pavilion am Leicester Square verfallen. Keiner seiner Verwandten und Freunde hätte es sich im Traum einfallen lassen, dieses Lokal aufzusuchen, und es war erst recht kein bevorzugter Tagungsort prominenter Paläontologen. Er hatte nicht erwartet, daß seine Wahl bei Ruth auf solche Begeisterung stoßen würde. Sie war hingerissen von den Mosaiken nach Art eines türkischen Bads, von den Topfpalmen und den schwarz gekleideten Kellnerinnen. Sie glaubte offensichtlich, sich im Nervenzentrum britischen gesellschaftlichen Lebens zu befinden.
Das Treffen hatte einen schlechten Start. Quin war verdrossen über einen, wie er fand, übertriebenen Ausbruch von Dankbarkeit.»Ruth, würden Sie bitte endlich aufhören, mir zu danken. Und ich nehme keinen Zucker.»
«Das weiß ich», versetzte Ruth gekränkt. «Ich weiß es noch aus Wien. Ich weiß auch, daß die vornehmen Leute erst den Tee eingießen und dann die Milch. Miss Kenmore hat mir erzählt, daß es die Königinmutter so macht. Aber von mir zu verlangen, daß ich Ihnen nicht danken soll, ist eine Zumutung. Sie haben mir schließlich das Leben gerettet, sie haben meinem Vater eine Arbeit besorgt, und jetzt lassen Sie mich doch in Thameside bleiben.»
«Hm, ja, ich hoffe, Sie haben es sich sehr gut überlegt. Ich weiß nicht, ob die Gerichte sich dafür interessieren, wie wir im einzelnen unsere Tage verbringen, aber Sie wissen, was Proudfoot über Kollusion gesagt hat. Wenn Heini hier ankommt und feststellen muß, daß Ihre Heirat mit ihm sich unnötig verzögert, wird er keineswegs erfreut sein. Ich denke, das sollten Sie in Betracht ziehen.»
«Oh, das habe ich getan. Aber ich weiß, daß es auch so gut sein wird. Heini geht es ja mehr um das Zusammensein an sich, wissen Sie. Und dazu wäre es schon viel früher gekommen, aber mein Vater hat die Glas-Wasser-Theorie nie verstanden. In seinem Beisein durfte man nicht einmal darüber sprechen.»
«Was ist denn das nun wieder – die Glas-Wasser-Theorie?»
«Ach, ganz einfach – die Liebe – die körperliche Liebe – ist wie ein Glas Wasser, das man trinkt, wenn man Durst hat. Sie ist etwas ganz Natürliches und den ganzen Wirbel, den man um sie macht, gar nicht wert.»
«Also, ich glaube, in meinem Beisein dürften Sie das auch nicht diskutieren», sagte Quin nachdenklich. «Mir klingt das sehr nach blühendem Unsinn.»
«Tatsächlich?» Ruth sah ihn erstaunt an. «Wie auch immer, ich glaube jedenfalls nicht, daß es Heini mit dem Heiraten so eilig hat. Er denkt nur an seine Karriere.»
«Wer weiß! Die internationale Lage wird seine Gedanken vielleicht auf anderes lenken. Ich könnte mir denken, daß er Sie so bald wie möglich vor Recht und Gesetz zu seiner Frau machen will. Aber nun habe ich meine Bedenken vorgebracht; wenn Sie sich darüber im klaren sind, was Sie tun, sage ich jetzt kein Wort mehr.»

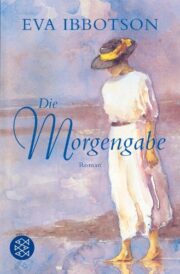
"Die Morgengabe" отзывы
Отзывы читателей о книге "Die Morgengabe". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Die Morgengabe" друзьям в соцсетях.