Verena hatte diese Freiheit nicht mißbraucht. Ihre Vorliebe hatte den Naturwissenschaften gegolten, und ohne alle Mühe bestand sie jede Prüfung, der sie sich unterzog, als Beste. Doch als sie das Vorstudium abgeschlossen hatte, bestand ihre Mutter darauf, sie nach England vorauszuschicken, um sie von ihren Verwandten aus Rutland, dem Stammsitz der Croft-Ellis', in die Londoner Gesellschaft einführen zu lassen.
So gut Lady Placketts Absichten waren, der Plan wurde kein Erfolg. Verena war in Socken einen Meter achtzig groß, und in Socken tanzt es sich nun einmal nicht sehr anmutig. Außerdem machte Verena kein Hehl daraus, daß die hohlköpfigen jungen Männer, über deren Köpfe sie beim Tanz hinwegsah, sie tödlich langweilten. Sobald ihre Eltern aus Indien eintrafen, teilte sie ihnen daher mit, daß sie vorhabe, den Magistergrad zu erwerben, und daß sie das an der Thameside-Universität tun werde.
Ihre Mutter war darüber nicht begeistert gewesen. Zwar hatte sie die Absicht gehabt, unter der Intelligenz des Landes nach einem Ehemann für Verena Ausschau zu halten, aber doch eher unter Nobelpreisträgern oder Mitgliedern der Royal Society und nicht gerade unter schlichten Dozenten, die meist in zerknittertem Cord und mit stinkenden Pfeifen daherkamen. Aber jetzt sah es ganz so aus, als hätte Verenas Instinkt sie richtig geführt. Beschwingten Schrittes eilte sie daher in das Zimmer ihrer Tochter hinauf.
«Verena! Ich muß dir etwas erzählen.»
Ihre Tochter saß an ihrem ordentlich aufgeräumten Schreibtisch. Vor sich hatte sie ein Lehrbuch mit Abbildungen und Diagrammen, rechts lagen ein aufgeschlagenes Heft und ein Drehbleistift, links lag ihr Lineal.
«Ja?»
Verena, die die engstehenden, abwärts gezogenen Augen und die römische Nase ihrer Mutter geerbt hatte, sah ohne Verstimmung über die Störung auf, obwohl sie gerade bei einem schwierigen Kapitel angelangt war und lieber ungestört geblieben wäre.
«Ich habe eben mit deinem Vater gesprochen, und dabei hat sich herausgestellt, daß Professor Somerville – der Leiter der zoologischen Abteilung – Quin Somerville ist, der Eigentümer von Bowmont. Frances Somervilles Neffe.»
«Ja, Mutter. Ich weiß.»
Ihre Mutter starrte sie an. «Du weißt das?»
Verena nickte. «Ich habe mich erkundigt. Deswegen habe ich mich ja für Zoologie entschieden. Er genießt einen hervorragenden Ruf.»
Nicht zum erstenmal staunte Lady Plackett über die Umsicht ihrer Tochter. Verena hatte den Sommer bei ihren Verwandten in Rutland verbracht, dennoch war sie bereits besser informiert als ihre Eltern.
«Ich werde ihn zum Essen einladen, sobald er wieder hier ist», sagte sie. «Zusammen mit einer ausgewählten kleinen Gruppe von Gästen. Du wirst natürlich neben ihm sitzen, damit ihr Zeit habt, euch zu unterhalten.»
Verena wandte sich wieder ihrem Buch zu. «Es wird mir ein Vergnügen sein», sagte sie.
Ruth ging durch das Tor der Thameside-Universität, grüßte den Pförtner in seinem Häuschen und betrachtete mit Entzücken den gepflegten Rasen, den alten Walnußbaum, das Standbild eines Mannes, der ausnahmsweise einmal nicht hoch zu Roß war.
Thameside war schön. Sie wußte, daß es eines der ältesten Bauwerke Londons war, aber diesen klösterlichen Frieden hatte sie nicht erwartet. Blumenbeete zogen sich zu Füßen der grauen Mauern entlang, und durch einen breiten Torbogen auf der anderen Seite des quadratischen Hofs bot sich ein atemberaubender Blick auf die Themse und die gewaltige Kuppel der St.-Pauls-Kathedrale auf dem anderen Ufer. Die Universität von Wien war größer, würdevoller, aber Ruth, die an den Fenstern von Bibliotheksräumen und Vorlesungssälen vorüberging, fühlte sich zu Hause.
Das Standbild war, wie sich zeigte, als sie es erreichte, das des Dichters William Wordsworth. Absolut passend, fand sie. Er hatte im Jahr 1802 auf der Westminster-Brücke gestanden und die Worte «Nichts Schön'res hat die Erde je geseh'n» gesprochen, mit denen sie, da sie soeben den Fluß überquert und mit eigenen Augen gesehen hatte, völlig übereinstimmte.
Ihr Termin bei Dr. Felton war für halb drei vereinbart. Ein Blick auf die Uhr über dem Torbogen zum Fluß zeigte ihr, daß sie noch zehn Minuten zeit hatte. Sie wollte sich solange ans Wasser setzen. Aber als sie sich zum Gehen wandte, hörte sie aus dem Keller des Naturwissenschaftlichen Baus zu ihrer Linken einen Laut, der unglaublich schwermütig klang. Sie drehte erstaunt den Kopf. Wieder vernahm sie den Laut. Diesmal erkannte sie ihn klar. Irgendwo dort unten befand sich, offenbar tief traurig und einsam, ein Schaf.
Sie stieg die Steintreppe hinunter, stieß eine Tür auf und trat in ein dunkles, staubiges Labor; ein Physiologielabor, ihr augenblicklich vertraut aus den Tagen in Wien, als sie, von den rotglühenden Blicken von tausend weißen Ratten begleitet, durch die Tierhaltungsräume der Universität gefahren war. Auch hier waren Ratten und die großen Behälter mit dem gelben Mais, von dem sie sich ernährten, eine Waage, Mikroskope, eine Zentrifuge ... und in einer Ecke, in einen hölzernen Pferch eingesperrt, stand ein weißgesichtiges, melancholisch dreinblickendes Schaf.
«Ja, natürlich, du fühlst dich einsam», sagte Ruth und trat näher. «Aber weißt du, ich darf dich nicht anfassen, weil du der Wissenschaft gehörst. Du bist ein Versuchstier. Du bist so ähnlich wie eine Vestalin – Höherem geweiht.»
Das Schaf stieß mit dem Kopf gegen die Wand seines Pferchs, dann sah es auf und blickte sie mit goldgelben Augen an. Ruth konnte nirgends Schläuche oder andere Anzeichen experimenteller Untersuchungen entdecken – das Schaf wirkte wohlgenährt und schien bei ausgezeichneter Gesundheit zu sein –, aber gut gedrillt, wie sie war, hielt sie sich dennoch von dem Tier fern.
«Ich kann mir vorstellen, daß du viel lieber woanders wärst», fuhr sie fort, «aber da bist du nicht allein. Zur Zeit gibt es massenhaft Leute, die lieber woanders wären. Überall in Belsize Park, in Finchley und in Swiss Cottage könnte ich dir solche Leute zeigen. Du gehörst einer edlen Rasse an, ich weiß, denn du kommst in den Psalmen vor, und der heilige Franz hat dir gepredigt. Ich weiß auch, warum; weil du Augen hast, die hören können.»
Das Schaf rammte seinen Kopf noch heftiger gegen die Wand des Pferchs, aber sein Blöken klang längst nicht mehr so melancholisch wie zuvor. Dann setzte es sich plötzlich, streckte ein Bein aus und reckte den Hals wie jemand, der einem Vortrag lauscht.
«Na schön, dann sag ich dir jetzt was von Goethe auf. Das wird dir bestimmt gefallen, er ist nämlich ein Dichter, bei dem es meistens sehr beschaulich zugeht, manchmal vielleicht ein bißchen schwermütig. Laß mich nachdenken, was würde dir gefallen?»
In seinem Zimmer im zweiten Stockwerk des Naturwissenschaftlichen Baus blies Dr. Roger Felton den Inhalt einer Pipette in einen Behälter mit Wasserschnecken und runzelte die Stirn. Eigentlich hätten jetzt Girlanden durchscheinender Eier im Tang hängen müssen, aber das war nicht der Fall. Natürlich konnte er sich jederzeit mehr Schnecken im Zoologischen Garten besorgen, aber er hatte es sich in den Kopf gesetzt, seine eigenen Tiere zu züchten – nicht nur für die Studenten, die seine Kurse in Meeresbiologie besuchten, sondern weil den Opisthobranchia mit ihren erstaunlich großen Nervenzellen sein besonderes Interesse galt.
Meerestiere aller Art – Seeigel, Seesterne, Garnelen, Tintenfische – schwammen, krochen, schwebten in Salzwasserbehältern, die durch ein kompliziertes System von Schläuchen und Pumpen gekühlt und belüftet wurden. Dr. Felton liebte sein Fach und unterrichtete es mit Leidenschaft und Begeisterung. Aber es gab Probleme, und nicht das geringste unter ihnen war der neue Vizekanzler, der keinen Zweifel daran gelassen hatte, daß für ihn Veröffentlichungen zählten, nicht die reine Lehrtätigkeit.
Roger Felton war sich darüber im klaren, daß er mehr Zeit auf die Forschung verwenden sollte, aber jemand mußte sich schließlich um die Studenten kümmern, wenn der Professor soviel unterwegs war. Er neidete Quin seine Reisen nicht – einen Mann solchen Kalibers in der Fakultät zu haben, war ein wahres Gottesgeschenk.
Dennoch – anstatt sich jetzt mit seinen Schnecken zu beschäftigen, mußte er die neue Studentin empfangen, die ihnen vom University College geschickt worden war, nachdem man dort offenbar Mist gemacht hatte. Er setzte sich an seinen Schreibtisch und zog sich Ruth Bergers Unterlagen heran. Was die Universität von Wien da über sie schrieb, war ja eine wahre Eloge. Sie würde, so schien es, ohne weiters im dritten Jahr anfangen und im Sommer ihr Abschlußexamen ablegen können. Sie hatte ausgezeichnete Noten mitgebracht, und ihr Vater war ein hervorragender Paläontologe. Selbst wenn der Professor keine Anweisung gegeben hätte, Flüchtlinge auf jeden Fall aufzunehmen, hätte er sich bemüht, einen Platz für dieses Mädchen zu finden.
Als es an seine Tür klopfte, blickte er in der Erwartung auf, Ruth Berger vor sich zu sehen. Statt dessen jedoch trat Dr. Elke Sonderstrom ein, groß, blond, mit der Figur einer Walküre. Sie war Dozentin in Parasitologie und hatte ihr Arbeitszimmer neben dem seinen.
«Komm einen Moment mit hinunter, Roger. Aber leise – sprich kein Wort.»
Roger Felton sah sie fragend an, aber Elke sagte nur: «Ich bin in den Keller gegangen, weil ich die Zentrifuge benutzen wollte, und – komm, du wirst es ja sehen.»
Verwundert folgte er ihr die zwei Treppen hinunter. Vor dem Keller wartete Humphrey Fitzsimmons auf sie, der lange, magere Physiologe.
«Sie ist noch da», flüsterte er und legte einen Finger auf die Lippen.
Das Labor war in Düsternis getaucht, doch an seinem hinteren Ende konnten sie einen hellen Schein ausmachen – das offene, in wirren Locken vom Kopf abstehende Haar eines jungen Mädchens. Das Mädchen selbst stand ganz vertieft über die Wand des Schafspferchs gebeugt.

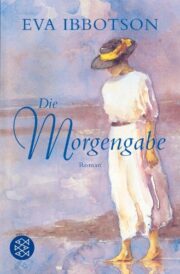
"Die Morgengabe" отзывы
Отзывы читателей о книге "Die Morgengabe". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Die Morgengabe" друзьям в соцсетях.