«Und ist sie mit ihm gegangen?»
Ruth lächelte. «Sie hat kein Wort gesagt. Sie hat den Lappen genommen und sehr sorgfältig die Flüsse Südamerikas von der Tafel gelöscht – den Negro und die Madeira und den Amazonas. Dann hat sie die Kreide in die Schachtel gelegt, hat einen Schrank aufgemacht, ihren Hut herausgenommen und aufgesetzt. Die Kinder hatten aufgehört zu kichern. Sie sperrten plötzlich Mund und Augen auf. Aber sie ist zwischen den Bänken hindurchgegangen, ohne sie zu sehen; sie existierten nicht mehr für sie. An der Tür bot Onkel Mishak ihr seinen Arm, und dann gingen beide über den Hof zur Straße hinaus, marschierten zur Donau und nahmen den Raddampfer nach Wien – und wurden im Dorf nie wieder gesehen.»
«Und sie sind glücklich geworden?»
Ruth hob eine Hand zu den Augen. «Sehr. Es war rührend, sie miteinander zu sehen – wie einer dem anderen die Kissen aufschüttelte, den Sessel zurechtrückte – all die kleinen Aufmerksamkeiten. Als sie starb, wollte er auch sterben, aber es gelang ihm nicht. Da hat meine Mutter ihn zu uns geholt.»
Wieder in der Innenstadt, zeigte ihm Ruth den Balkon, auf den sie sich mit neun Jahren eines Nachts splitterfasernackt in der Hoffnung hinausgestellt hatte, sie werde sich eine Lungenentzündung holen, die sie von Schmach und Schande erlösen würde.
«Es war die Wohnung meiner Großtante, und ich hatte gerade gehört, daß ich in der Musikprüfung nur ein <sehr lobenswert> bekommen hatte und kein <äußerst lobenswert>. Ach, und da ist die Bank, auf der meine Mutter saß, als die Tauben über sie herfielen und mein Vater sie retten mußte.»
«In Ihrer Familie scheint es viele glückliche Ehen gegeben zu haben», bemerkte Quin.
«Ich weiß nicht – Onkel Mishak war glücklich, und meine Eltern waren es auch ... aber ich glaube nicht, daß bei uns die Ehe als das betrachtet wurde, was einen glücklich macht.»
«Was dann?»
Ruth krauste die Stirn und wickelte eine Haarlocke um ihren Finger. «Die Arbeit an einem Ziel – das Festhalten an etwas, das man sich vorgenommen hatte. Geduld und Ausdauer – wie wenn man ein Feld umpflügt. Oder wie wenn man ein Bild malt – man fügt immer wieder neue Farben hinzu und bemüht sich, die richtige Perspektive zu bekommen. Das galt besonders für die Frauen. Meine Tante Miriam war mit einem Mann verheiratet, der sie dauernd betrogen hat. Immerzu hat sie meine Mutter angerufen und gesagt, sie würde ihn umbringen. Aber als jemand ihr vorschlug, sich scheiden zu lassen, war sie entsetzt.» Ruth blickte auf und drückte hastig eine Hand auf den Mund. «Entschuldigen Sie – ich habe natürlich nicht von uns gesprochen. Das waren richtige Ehen, keine Vernunftehen.»
Ihr letzter Besuch galt dem Stephansdom, Symbol und Herzstück der Stadt.
«Ich würde gern eine Kerze anzünden», sagte Ruth, und er ließ sie allein durch das dämmrige, nach Weihrauch duftende Schiff zum Altar gehen. Während er draußen vor dem Portal wartete, sah er, wie auf der anderen Seite des Platzes zwei verängstigte hellhaarige junge Burschen mit breiten Bauerngesichtern von einer Gruppe Soldaten zu einem Militär-Lkw geschleift wurden.
«Sie treiben jetzt die ganzen Sozis zusammen», sagte eine rundliche Frau mittleren Alters mit einer Feder im Hut. In ihrer Stimme war kein Tadel; in dem runden, blassen Gesicht zeigte sich keine Gefühlsregung.
Als er in die Kirche trat, um Ruth zu holen und sie durch eine Seitentür hinauszuführen, sah er, daß sie nicht eine Kerze, sondern deren zwei angezündet hatte. Unnötig zu fragen, für wen – bei diesem Mädchen führten alle Wege zu Heini.
«Was glauben Sie, werde ich je hierher zurückkommen?»
Quin antwortete nicht. Ob Ruth in diese zum Tode verurteilte Stadt zurückkehren würde, konnte er nicht sagen; aber für ihn war klar, daß er und andere seinesgleichen hierher kommen würden, denn es gab kein anderes Mittel, diesem Unheil Einhalt zu gebieten, als den Krieg.
7
Heini war seit zehn Tagen in Budapest. Es war schön, wieder zu Hause zu sein; den Corso am Fluß entlangzuspazieren und zur Burg auf dem Burgberg hinaufzuschauen; die Schiffe auf ihrer Fahrt zum Schwarzen Meer vorbeigleiten zu sehen, wieder das feurige Gulasch zu schmecken, von dem die Wiener sich nur einbildeten, sie könnten es auch kochen. Hier waren eine Spritzigkeit, ein Esprit zu Hause, die in der österreichischen Hauptstadt fehlten, und die Frauen waren schöner als sonstwo auf der Welt. Für Heini allerdings waren sie keine Verlockung – er fand es nur allzu leicht, Ruth treu zu bleiben; außerdem war man besser vorsichtig, wenn man sich keine Krankheit holen wollte.
Sein Vater lebte noch in der gelben Villa auf dem Rosenhügel; die Apfelbäume im Garten standen in voller Blüte; sie nahmen ihre Mahlzeiten auf der Veranda ein, von der man auf das Grabmal des Pascha hinunterblickte und über die bewaldeten Hänge hinweg zum gotischen Filigran der Parlamentsgebäude und zu den Giebeln und Dächern von Pest.
Heini mochte seine Stiefmutter nicht; es fehlte ihr an Seele, aber er war froh, daß jemand da war, sich um seinen Vater zu kümmern, der noch immer bei der einzigen liberalen deutschen Zeitung der Stadt arbeitete.
Es machte keine besonderen Schwierigkeiten, ein Visum für Großbritannien zu bekommen. Ungarn war noch unabhängig, und es gab keinen allgemeinen Run, das Land zu verlassen; das Kontingent war noch nicht voll. Zwar würde es etwas länger dauern als erwartet – einige Wochen –, aber es gab keinerlei Anlaß zur Beunruhigung.
Am erfreulichsten fand es Heini nach seiner Rückkehr, daß es seinem alten Klavierprofessor gelang, ein Konzert für ihn zu arrangieren.
«Ich hätte gern einen wirklich großartigen Auftritt für Sie organisiert», sagte Professor Sandor und erwähnte den Vigado, den berühmten Konzertsaal, in dem Rubinstein gespielt und Brahms dirigiert hatte, «aber dazu war die Zeit zu kurz – und wer weiß, wenn Sie hier in der Musikhochschule spielen, kommt vielleicht Bartok, und das könnte für Sie eine große Chance sein.»
Heini war angemessen dankbar. Er erinnerte sich des alten Hauses mit Wärme. Schon Liszt hatte hier gelehrt, und nun konnte sich die Hochschule mit Bartok, Kodäly und Dohnányi eines Musikerdreigespanns rühmen, auf das jede Musikhochschule der Welt stolz gewesen wäre. Er sollte im großen Saal ein Solokonzert geben und die Hälfte der Einnahmen bekommen. Professor Sandor war wirklich die Hilfsbereitschaft und die Generosität in Person.
Aber die Sache hatte einen Haken. Das Konzertkomitee hatte zur Auflage gemacht, daß Heini die Sonate in sein Programm aufnahm, die die Meisterklasse des Klavierlehrgangs in diesem Jahr studierte: Beethovens schwieriges und schönes Opus 99. Heini hatte nichts dagegen einzuwenden. Er würde die Sonate allerdings vom Blatt spielen müssen – und das hieß, daß er jemanden brauchte, der ihm die Noten umblätterte.
Ja, und da kam nun gewissermaßen Sand ins Getriebe. Professor Sandor hatte nämlich eine Tochter, ebenfalls Studentin an der Hochschule, die er Heini als Hilfe empfahl.
«Sie werden sehen, daß man gut mit ihr zusammenarbeiten kann», hatte der Professor versprochen. Mali kam also zu Heinis erster Probe wie vereinbart – und es wurde eine Katastrophe.
Das Mädchen war nicht nur reizlos – ein unscheinbares Äußeres hätte ihn nicht gestört –, sondern ausgesprochen häßlich; ihre Brillengläser fingen das Licht ein und blitzten irritierend; außerdem hatte sie vorstehende Zähne. Als würde das noch nicht genügen, machte sie ihn fast wahnsinnig mit ihrer devoten Diensteifrigkeit, ihrem Bemühen, sich ja nützlich zu machen, und obwohl sie als Studentin der Hochschule natürlich Noten lesen konnte, war sie so zögerlich, hatte solche Angst davor, voreilig zu sein, daß er mehrmals am Ende des Blattes nicken mußte. Aber das schlimmste war, daß Mali schwitzte.
Heini vermißte Ruth jeden Tag, seit er in Budapest zurück war, aber in den Tagen vor dem Konzert wurde seine Sehnsucht nach ihr zu einem dauernden Schmerz. Ruth blätterte mit solcher Anmut, mit solchem Geschick die Seiten um, daß man kaum merkte, daß sie da war; sie duftete süß und zart nach Lavendelshampoo, und nicht ein einziges Mal in all den Jahren, seit sie an seiner Seite saß, hatte er nicken müssen.
Zu Heinis Kümmernissen trug ferner die Tatsache bei, daß seine Stiefmutter keine Ahnung hatte, welche inneren Spannungen der bevorstehende öffentliche Auftritt für ihn mit sich brachte. Heinis Hände waren natürlich versichert, und sie wie seine Augäpfel zu hüten, war ihm zur zweiten Natur geworden; aber ein Pianist spielte mit dem ganzen Körper, und als er über ein Kehrschäufelchen stolperte, das seine Stiefmutter auf der Treppe stehengelassen hatte, geriet er darüber ziemlich in Rage.
«Ich bin nicht pingelig», sagte er zu Marta, «aber wenn ich mir den Knöchel verstaucht hätte, könnte ich einen Monat lang das Pedal nicht betätigen.»
Bei den Bergers, deren Wohnung ihm ein zweites Zuhause geworden war, war alles so herrlich anders gewesen. Da hatte nicht nur Ruth, sondern auch ihre Mutter und das Personal ihm mit Freuden gedient; geradeso wie er mit Freuden seiner Muse, der Musik, diente.
Am Tag des Konzerts wurde Heinis Sehnsucht nach Ruth vollends zur Qual. Der Tag begann schon schlecht. Früh um neun bereits weckte ihn das durchdringende Brummen des Staubsaugers vor seiner Zimmertür, obwohl er doch am Tag eines Konzerts stets ausschlafen mußte. Als er sich beschwerte, erklärte ihm seine Stiefmutter, das Mädchen müsse mit seiner Arbeit fertig werden, und machte ihn darauf aufmerksam, daß er bereits zehn Stunden im Bett zugebracht hatte.
«Im Bett, ja, aber ich habe nicht geschlafen», entgegnete Heini bitter – doch im Grund erwartete er gar nicht, daß sie ihn verstand.

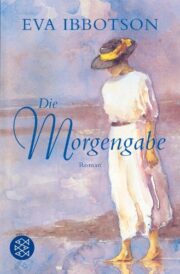
"Die Morgengabe" отзывы
Отзывы читателей о книге "Die Morgengabe". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Die Morgengabe" друзьям в соцсетях.