«Ich weiß nicht, was es ist, Angie«, murmelte er verwirrt in Angies duftendes Haar.»Ich kann nicht von diesen Schriftrollen lassen. Es ist fast, als ob. als ob.«
Sie wich zurück und schaute mit tränenüberströmtem Gesicht zu ihm auf.»Sag’s nicht, Ben!«
«Ich muß, Angie. Es ist fast, als ob David Ben Jona einen Alleinanspruch auf mich erheben würde.«
«Nein!«schrie sie.»Du kannst davon loskommen. Du kannst, Ben. Ich werde dir dabei helfen.«
«Aber ich will ja gar nicht, Angie. Kannst du das nicht begreifen? Von Anfang an wollte er mich besitzen. Und jetzt hat er mich. Ich will nicht vor ihm davonlaufen, Angie. Er ist nun da, und ich kann ihm nicht entkommen. Ich muß herausfinden, was er versucht, mir mitzuteilen.«
Vor Ben gähnte der schwarze Abgrund, und er wußte, daß er im nächsten Augenblick hineinfallen würde.
«Ich werde nicht länger gegen ihn ankämpfen, Angie. Ich muß mich David völlig hingeben. Die Antwort liegt in diesen Rollen, und ich muß sie finden.«
Als Ben in den Abgrund des Vergessens hinabstürzte und die Wirklichkeit weit hinter sich ließ, hörte er noch, wie Angies Stimme ihm von weither zurief:»Ich liebe dich, Ben. Ich liebe dich so sehr, daß ich sterben könnte. Aber ich bin drauf und dran, dich zu verlieren, und weiß nicht einmal, an wen. Wenn es eine andere Frau wäre, wie diese Person, diese Judy, dann wüßte ich, mit welchen Waffen ich mich zu wehren hätte. Aber wie kann ich gegen einen Geist kämpfen?«Er wandte sich von ihr ab, da die magische Anziehungskraft der verbleibenden Fotos wieder auf ihn zu wirken begann. Er mußte zurück zu David.»Bitte, geh nicht weg von mir!«flehte sie.
Ben war über sich selbst erschrocken. Es war, als hätte er keine Kontrolle mehr über seinen Körper. Zum erstenmal in ihrer Beziehung zeigte Angie wahre Gefühle. Der Anblick ihrer blassen, zitternden Lippen und ihrer von Wimperntusche verschmierten Augen erschreckte ihn. Er hatte noch nie erlebt, daß Angie eine solche Szene machte. Er hatte nicht einmal geglaubt, daß sie dazu imstande wäre. Doch da stand sie nun, flehend und in Tränen aufgelöst. Unter anderen Umständen hätte Angies Auftritt Ben tief bewegt, aber in diesem Augenblick verfehlte er seine Wirkung völlig.»Ich kann es nicht ändern, Angie«, hörte er sich selbst sagen.»Ich kann nicht erklären, was es ist, aber es gibt in meinem Leben keinen Platz mehr für irgend etwas anderes als diese Schriftrollen. Ich muß Davids Worte lesen. Er verlangt nach mir.«
«Und ich verlange auch nach dir, Ben. Mein Gott, was geschieht nur mit dir?«
Doch er mußte von ihr weggehen. Er hatte David Ben Jona am Rande des Selbstmords inmitten von Elend und Hoffnungslosigkeit verlassen, und Ben mußte zu ihm zurückkehren. Das Bedürfnis, immer weiter zu lesen, wurde übermächtig. Er konnte sich Davids Einfluß nicht widersetzen.
Ben ließ sich wieder an seinen Schreibtisch nieder und wandte sich den aramäischen Buchstaben zu. Er hörte nicht mehr, wie Angie leise die Wohnung verließ.
Am oberen Rand des nächsten Fotos stand:»Mein Unglück läßt sich nicht mit Worten beschreiben. «Dann schilderte David seine Einsamkeit und Verzweiflung, als er durch die Straßen Jerusalems irrte, ohne einen Freund, ohne einen Ort, wohin er gehen konnte, und — was das Schlimmste war — von Gott verlassen.
«Wegen eines Augenblicks der Schwäche verlor ich alles, wonach ich gestrebt hatte; brachte Schande über mich und meine Familie, verlor die Frau, die ich liebte, und wurde von Gott verlassen. Konnte es ein erbärmlicheres, verachtenswerteres Geschöpf geben als mich?«
An dieser Stelle legte Ben seinen Kopf auf die Arme und schluchzte. Er weinte, als ob er selbst derjenige gewesen wäre, der einsam und allein, ohne Familie oder Freunde, durch die Straßen Jerusalems irrte, der Schande über den Namen seines Vaters gebracht hatte und von seinen Lieben verstoßen wurde; als ob er, Ben Messer, dafür verantwortlich wäre, daß ihm
Gottes Liebe nunmehr versagt blieb. Es riß ihm Herz und Seele aus dem Leib. Ihm war übel, kalt und hundeelend. Indem er David Ben Jonas Leid auf sich nahm, durchlebte Ben Messer noch einmal jenen schrecklichen Tag vor zweitausend Jahren.
Und als er die Last von Davids Not schließlich nicht mehr länger ertragen konnte, sprang er mit einem Satz auf und stolperte blind zum Telefon. Er wählte, ohne nachzudenken, und als sie antwortete, sagte er in einer Stimme, die nicht seine war:»Judy, kommen Sie bitte. Ich brauche Sie.«
Kapitel Zehn
Mein Unglück läßt sich nicht mit Worten beschreiben. Hatte es je zuvor eine elendere Kreatur als mich gegeben, eine solche Schande für die Menschheit? In meiner Trunkenheit hatte ich der Thora den Rücken gekehrt und ihre Gesetze entweiht. So war es jetzt nur gerecht, wenn Gott sich von mir abwandte. Wie betäubt wanderte ich durch die Straßen und klammerte mich an das kleine Bündel mit meinen Habseligkeiten. Ich war völlig verwirrt und hatte keine Ahnung, wohin ich mich wenden sollte. Nach Magdala konnte ich nicht zurückkehren, da ich sonst die Schmach meiner Familie noch vergrößert hätte. Außerdem wußte ich, daß mein Vater mich ohnehin davonjagen würde. Ich wagte nicht, zu meiner Schwester zu gehen und Schande über ihr Haus zu bringen. Ich hatte weder Geld für ein Zimmer in einem Wirtshaus, noch besaß ich die Mittel, um Judäa zu verlassen. Ich hatte kein Talent, keinen Beruf, um mich selbst zu ernähren. Ich konnte nicht länger die sanfte Rebekka anschauen. Und am schlimmsten von allem war, daß Gott mich verlassen hatte. Wegen eines Augenblicks der Schwäche hatte ich alles verloren, wonach ich gestrebt hatte; hatte Schande über mich und meine Familie gebracht, die Frau, die ich liebte, verloren und wurde von Gott verlassen. Konnte es ein erbärmlicheres, verachtenswerteres Geschöpf geben als mich?
Mir blieben nur zwei Möglichkeiten: entweder in der Stadt zu bleiben und um Almosen zu betteln oder aufs Land zu gehen und darauf zu hoffen, mit Feldarbeit etwas Brot zu verdienen. Keine dieser Aussichten war sehr ermutigend, und ich wünschte mir von ganzem Herzen, ich wäre niemals geboren worden. Ich wanderte den ganzen Tag über durch fremde Straßen und stieß dabei auch in mir unbekannte Teile der Stadt vor. Als ich bei Sonnenuntergang vom vielen Laufen erschöpft war, ließ ich mich an einem Brunnen nieder, wo mehrere Frauen gerade ihr letztes Wasser schöpften. Ihr Anblick erinnerte mich an die Tage, die ich damit verbracht hatte, Eleasars Wasservorräte aufzufüllen, und daran, wie ich es damals eingerichtet hatte, in der gleichen Zeit auch der Witwe das Wasser nach Hause zu tragen. Die Schekel, die sie mir bezahlt hatte, befanden sich unter denen, die ich, völlig kopflos, in der Nacht zuvor Salmonides gegeben hatte. Und der Gedanke daran erfüllte mich mit bitterem Schmerz.
Wie ich so auf dem Brunnenrand saß und hinunterblickte, sah ich den Ausweg aus meiner schlimmen Lage auf seinem trüben Grund. Zu sterben wäre so einfach, so leicht. Da es für mich ohnehin keinen Sinn mehr hatte, zu leben, würde ich meinem Elend durch den Tod entrinnen. Und alles, was ich zu tun brauchte, war loszulassen, mich fallenzulassen.
Es war die Stimme einer Frau, die mich davon abhielt weiterzugehen. Sie hatte in der Nähe ihr Wasser heraufgezogen und war schon abmarschbereit, blieb aber hinter den anderen zurück, um mich zu beobachten.»Guten Abend, Bruder, geht es dir gut? Du siehst müde aus«, hörte ich sie sagen.
Ich warf erst einen flüchtigen Blick über meine Schulter, um zu sehen, mit wem sie sprach, und da ich niemanden gewahrte, schaute ich sie überrascht an. Sie war eine ältere Frau, möglicherweise älter als meine eigene Mutter, und doch noch sehr stattlich und wohlgekleidet.
Sie kam näher an mich heran.»Geht es dir gut?«erkundigte sie sich abermals.
Dann fiel mir ein, daß ich eigentlich gar keinen Grund hatte, überrascht zu sein, daß sie mit mir sprach. Denn schließlich konnte sie ja nichts von meiner Schande wissen.»Es geht mir nicht gut«, erwiderte ich.»Und ich bin todmüde.«
«Bist du auch hungrig?«Ihre Stimme klang gütig. So antwortete ich ihr:»Bevor Ihr Euch meiner erbarmt, gutes Weib, ist es nur recht und billig, wenn ich Euch vor mir warne. Ich bin ein schändlicher Kerl, ein von der eigenen Familie Verstoßener. Es gibt keinen Mann, der mich Freund nennt, und keine Frau, die mich Bruder nennt.«
Doch sie sprach:»Es interessiert mich nicht, was du getan hast. Ich sehe nur, daß du müde und hungrig bist. Wir haben in meinem Haus eine Menge zu essen und einen Platz, wo du schlafen kannst. Du kannst gerne mit mir kommen. «Ich protestierte ein zweites Mal:»Ich bin verbannt, gute Frau. Ihr würdet einem Verfluchten Einlaß in Euer Haus gewähren.«
Doch sie entgegnete:»Es obliegt Gott, über dich zu richten, nicht mir.«
Und ich widersprach ein drittes Mal:»Würdet Ihr eine Giftschlange mit nach Hause nehmen?«
Und da lächelte sie und meinte:»Selbst die Giftschlange sucht ihre Opfer nicht unter ihren Artgenossen.«
Zu matt, um noch weiter zu streiten, und verlockt durch die Aussicht auf Essen, begleitete ich die Frau nach Hause. Dort traf ich mehrere Leute, die mich als einen der Ihren aufnahmen und das Brot mit mir brachen. Sie waren fromme Juden, die makellos weiße Gewänder und Gebetsriemen an Stirn und Arm trugen. An diesem Abend bekam ich eine Matratze zum Schlafen und das Angebot, so lange zu bleiben, wie ich wollte.
Aber nach kurzer Zeit beschloß ich, Miriams Haus — so hieß die gute Frau — wieder zu verlassen, denn seine Bewohner waren ehrwürdige Leute, die beteten, bis ihre Knie gefühllos wurden. Ich spürte, daß meine Gegenwart sie befleckte. Nicht ein einziges Mal versuchten sie herauszufinden, welch schändliche Tat ich begangen hätte. Auch behandelten sie mich in keiner Weise als Fremden, sondern schienen nur um meine Gesundheit besorgt zu sein. Als ich ihnen zwei Tage später meinen Abschied ankündigte, stellten sie mir keine Fragen. Statt dessen gaben sie mir ihren Segen und steckten mir ein paar Schekel in den Beutel.

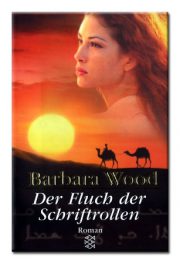
"Der Fluch der Schriftrollen" отзывы
Отзывы читателей о книге "Der Fluch der Schriftrollen". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Der Fluch der Schriftrollen" друзьям в соцсетях.