Mary stellte ihre Tasse auf den Klapptisch und legte beide Hände auf ihren Bauch. »Ich werde morgen geröntgt«, sagte sie. »Dr. Wade hat gesagt, es wäre alles in Ordnung, er will nur die Entwicklung des Kindes genau überwachen.« Sie hob den Kopf und sah Gloria mit ihren kühlen blauen Augen an. »Ist das normal, daß man geröntgt wird?«
Sie sah den Schatten, der über Glorias Gesicht flog, ehe diese sich abwandte. »Mary, meine letzte Schwangerschaft ist so lange her, daß ich gar nicht weiß, was heutzutage zum normalen Behandlungsablauf gehört.«
»Aber Dr. Wade hat Angst, daß etwas nicht in Ordnung ist, stimmt's?«
Gloria wandte sich ihr wieder zu. »Du hast es doch eben selbst gesagt, Mary. Du bist ein besonderer Fall. Ich denke, dein Arzt möchte lediglich alles Menschenmögliche tun, um sicherzustellen, daß es dir und deinem Kind gutgeht. Ganz gewiß hast du keinen Anlaß, dir Sorgen zu machen.«
Die angenehm rauhe Stimme, die so bestimmt und sicher klang, und das klare Lächeln auf dem unscheinbaren, aber sympathischen Gesicht beruhigte Mary. Sie nahm ihre Tasse und trank den letzten Schluck Tee, und dabei fiel ihr plötzlich auf, daß sie über diesem offenen, warmen Gespräch mit Gloria Renfrow den ursprünglichen Grund ihres Kommens völlig vergessen hatte.
Sie sah die Frau neben sich beinahe herausfordernd an und sagte: »Sind Sie katholisch?«
Die Frage schien sie nicht zu überraschen. »Warum? Würde das für dich etwas ändern? Würde das -« Gloria senkte die Stimme ein wenig - »die Sünde deines Vaters mildern?«
Mary antwortete nicht.
»Ich kann und will nicht für deinen Vater sprechen«, fuhr Gloria ruhig fort. »Was er zu sagen hat, muß er dir selbst sagen. Aber was mich angeht ... Ich war plötzlich allein mit drei halbwüchsigen Jungen und fühlte mich sehr allein gelassen. Und gerade in dieser Zeit, wo mir so sehr jemand fehlte, an den ich mich einmal anlehnen konnte, trat dein Vater in mein Leben. Aber bitte glaub jetzt ja nicht, ich hätte ihn mit List und Tücke zum Ehebruch verführt. Dein Vater war damals auch in einer Situation, wo er dringend jemanden brauchte. So etwas geht immer nur, wenn beide wollen.«
Sie schwieg einen Moment. »Glaub mir«, sagte sie dann, »es ist nicht leicht, die Freundin oder Geliebte eines verheirateten Mannes zu sein.« Ihre Stimme wurde ein wenig brüchig. »Obwohl ich ihn von ganzem Herzen liebe und alles für ihn tun möchte, muß ich immer im Hintergrund bleiben und mich mit einem zweiten Platz in seinem Leben begnügen. Es ist, als lebte man immer im Schatten. Ich kann ihn niemals anrufen, wenn ich traurig bin. Ich kann niemals an den Wochenenden oder im Urlaub mit ihm Zusammensein; ich kann nicht mit ihm ausgehen oder verreisen. Wenn ich ihm ein Geschenk mache, kann er es nicht mit nach Hause nehmen. Ich muß mich damit zufriedengeben, jede Woche ein paar Stunden mit ihm zu verbringen, und mehr nicht. Und wenn du glauben solltest, daß ich mich von ihm aushalten lasse, dann schlag dir das mal ganz schnell aus dem Kopf. Ich bin berufstätig und verdiene mir allein meinen Lebensunterhalt. Dein Vater gibt mir kein Geld. Und ich will auch keines. Ich will nur ihn
selbst.«
Marys Augen brannten. »Aber wenn er meine Mutter so unerträglich findet, warum verläßt er sie dann nicht?«
»Er findet sie nicht unerträglich, Mary. Vielleicht kannst du das jetzt noch nicht verstehen, aber dein Vater liebt sie und er liebt mich. Nur auf unterschiedliche Weise. Du weißt nicht viel von Männern, Kind, und auch wenn du mal so alt bist wie ich, wirst du vieles nicht verstehen.« Sie lachte kurz und bitter. »Und da heißt es immer, die Frauen seien geheimnisvoll!«
»Und - und Sie lieben ihn wirklich?«
»Ja, ich liebe deinen Vater, Mary.«
Mary kämpfte mit den Tränen.
»Sei ihm nicht böse, Mary«, sagte Gloria. »Ich hoffe, wenn du älter bist, wirst du ihn verstehen.«
»Aber wie kann er nur!« stieß sie weinend hervor. »Er ist streng katholisch -«
»Mary, was glaubst du denn, warum dein Vater hierher kommt? Ich weiß, was du denkst, und du täuschst dich, Kind. Natürlich war das Sexuelle am Anfang wichtig, das will ich gar nicht bestreiten. Es hat eine große Rolle gespielt. Ich denke, daß es für viele einsame Menschen der einfachste Weg ist, sich gegenseitig zu trösten. Aber das ist sieben Jahre her. Soll ich dir sagen, was wir hier jeden Mittwochabend tun, Mary? Dein Vater kommt herein, zieht seine Schuhe aus und setzt sich mit mir zusammen vor den Fernseher. Manchmal spielen wir Karten. Oder er richtet mir den Wasserhahn in der Küche. Oder wir setzen uns in den Garten und schauen zu, wie die Sonne untergeht. Und hin und wieder schlafen wir auch zusammen.
Mary, ich weiß, warum du hergekommen bist. Seit dein Vater mir neulich von eurem Gespräch erzählt hat, habe ich dich erwartet. Du hast deinen Vater als Heiligen gesehen. Und jetzt stellst du fest, daß er auch nur ein Mensch ist. Du bist wütend auf ihn - und vermutlich auch auf mich -, daß er dir das antut. Du bist hergekommen, weil du hofftest, du würdest den Heiligen zurückbekommen; du hofftest, ich würde alles bestreiten, und du könntest deinen Vater dann wieder aufs Podest heben. Ich kann es verstehen, ich hatte auch einen Vater ... Aber ich kann dir diesen Gefallen nicht tun, Mary.
Du solltest mich nicht verachten. Das Recht dazu hast du dir noch nicht verdient. Um über mich urteilen zu können, brauchst du selbst erst eine gewisse Lebenserfahrung und Reife. Mein Leben ist einsam, weil ich einen Mann liebe, den ich niemals haben kann. Ich habe mich mit der Zukunft ausgesöhnt. Vielleicht solltest du das auch tun.«
Mary wischte sich die Tränen aus den Augen und sah Gloria an.
»Ich werde deinem Vater nicht sagen, daß du hier warst«, fuhr Gloria fort. »Wenn du es ihm sagen möchtest, gut, das ist deine Entscheidung. Es gibt Dinge im Leben deines Vaters, die er nur mir erzählt hat, Mary. Nicht einmal deine Mutter weiß davon. Und sie alle haben damit zu tun, daß er hierherkommt. Aber es ist seine Sache, dir davon zu erzählen .«
»Ich weiß nicht, was ich denken soll«, sagte Mary. »Es ist, als ob - als ob alles anders geworden wäre.« Sie dachte an Mike und Germaine und ihre Eltern, und an ihr eigenes Leben. »Nichts ist mehr so, wie es war.«
»Das ist richtig, Kind, und nichts im Leben kann für immer so bleiben, wie es ist, so sehr wir uns das auch manchmal wünschen. Als ich damals Sam in der Küche liegen sah, so friedlich, als hätte er sich hingelegt, um ein Nickerchen zu machen, da hatte ich ein Gefühl, als stünde ich am Rand eines schwarzen Abgrunds. Und manchmal, wenn ich es zulasse, kommt dieses Gefühl wieder, und dann kommen mir lauter dumme Gedanken. Ich zerfließe vor Selbstmitleid und sage mir, daß es keinen Sinn hat weiterzumachen. Aber -«
Mary sah erstaunt, daß Gloria die Tränen in die Augen getreten waren. Impulsiv beugte sie sich vor und legte ihre Hand auf Glorias Arm. Die lächelte und drückte ihr die Hand.
»Ich gehöre nicht zu den Frauen, die stumm in sich hineinweinen können, ohne eine Träne zu vergießen. Ich heule und schniefe und kriege ein total verschwollenes Gesicht, wo ich doch von Natur aus schon nicht zu den Schönsten gehöre.« Sie lachte ein wenig. »Ach, du hast schon ausgetrunken. Möchtest du noch eine Tasse?«
Zweieinhalb Stunden später stellte Mary den Chevrolet in der Auffahrt ab, sperrte leise die Haustür auf und trat in den dunklen Flur. Auf Zehenspitzen schlich sie zur offenen Tür des Wohnzimmers, aus dem gedämpftes Licht fiel. Sie war nicht überrascht, ihren Vater dort auf dem Sofa sitzen zu sehen, allein, ein Glas in der Hand. Sein Gesicht war halb im Schatten, die Schultern hingen schlaff nach vorn. Er sah alt und verbraucht aus.
»Daddy!« sagte sie leise.
Er zuckte ein wenig zusammen und sah auf.
Mary trat zaghaft einen Schritt ins Zimmer. Er stellte sein Glas auf den Tisch und sah ihr stumm entgegen. Sie rannte zu ihm, warf sich neben ihn aufs Sofa und schlang die Arme um seinen Hals.
»Ach, Daddy«, murmelte sie. »Es tut mir leid. Es tut mir so leid.«
Sie sprachen bis weit nach Mitternacht miteinander. Er sprach von seiner Beziehung zu Gloria und dann von jenen Dingen in seinem Leben, die er außer dieser Frau bisher keinem Menschen anvertraut hatte.
Ted McFarland glaubte, daß er in einem Zelt am Stadtrand von Tuscaloosa zur Welt gekommen war, aber er war nicht sicher. Seine früheste Erinnerung galt einer stickig heißen Nacht in einem heruntergekommenen Holzschindelhaus, wo es nach Alkohol stank und aus einem Nebenzimmer die gequälten Schreie einer Frau drangen. Er hockte auf dem nackten Holzfußboden, und im milchigen weißen Licht ging ständig ein großgewachsener, hagerer Mann hin und her und murmelte unablässig den Namen des Herrn. Flüsternde Frauen tauchten flüchtig aus den Schatten und verschwanden wieder, und am Ende dieser langen, heißen Nacht traten sie laut klagend mit einem leblosen Bündel auf den Armen aus dem Nebenzimmer. So war Teds Mutter gestorben.
Hoseah McFarland war Wanderprediger. Nach dem Tod seiner Frau hatte er seine wenigen Habseligkeiten zusammengepackt und war mit seinen Söhnen durch die Südstaaten gezogen. Sie lebten in Zelten, und während Hoseah, der Verkünder der frohen Botschaft, den Sündern dieser Welt mit Hölle und Verdammnis drohte, mußten seine Söhne mit dem Hut herumgehen, der unweigerlich bis zum Rand voll wurde. Als Ted dreizehn war, drückte ihm sein Vater ein Paar Krücken in die Hand, zeigte ihm, wie er ins Zelt zu hüpfen hatte und nach der Predigt die Krücken wegwerfen und nach vorn, zum Podium, stürzen mußte, um Gott und Hoseah McFarland für das Wunder zu danken, das an ihm geschehen war.
Ted machte seine Sache ausgezeichnet. Die armen Schwarzen und das >weiße Pack< spendeten, was sie hatten. Hoseah wurde ein wohlhabender Mann. Und wenn Ted nach der

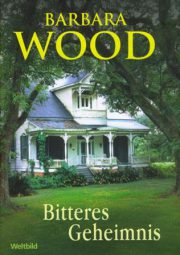
"Bitteres Geheimnis(Childsong)" отзывы
Отзывы читателей о книге "Bitteres Geheimnis(Childsong)". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Bitteres Geheimnis(Childsong)" друзьям в соцсетях.