»Mary, bitte hör mir zu.« Jonas war erschrocken und unsicher. Er wußte nicht, was er tun sollte. Er hatte Angst, Mary könnte einfach davonlaufen. »Ich habe mich mit deinem Fall beschäftigt und einige erstaunliche Entdeckungen gemacht.« Er griff zur Aktentasche, die zu seinen Füßen stand.
»Ich brauche Sie jetzt nicht mehr, Dr. Wade.« Sie musterte ihn kühl, als sie aufstand. »Von jetzt an verlasse ich mich nur noch auf Sebastian.«
Ohnmächtig mußte Jonas Wade zusehen, wie sie davonging und die Tür hinter sich schloß. Danach saß er lange Zeit in seinem Sessel und tat gar nichts, bis er schließlich das Telefonbuch und die Nummer des Pfarrhauses von St. Sebastian heraussuchte.
»Mutter?« Mary öffnete die Tür und schaute in die Küche. Drinnen war es kühl und dunkel. Sie ging weiter ins Eßzimmer, sah zur sonnigen Terrasse hinaus und rief wieder: »Mutter? Ist keiner da?«
Aus dem Wohnzimmer hörte sie Geräusche. Der Fernsehapparat war eingeschaltet, aber es saß niemand davor. Mary ging hin und machte ihn aus. Sie lauschte in die Stille. Nichts rührte sich.
Auf dem Weg zu ihrem Zimmer kam sie an Amys Tür vorbei und sah, daß sie nur angelehnt war. Sie blieb stehen und stieß die Tür ein Stück auf. »Hallo! Warum hast du dich nicht gerührt?«
Amy hockte auf ihrem Bett, den Rücken an die Wand gelehnt, die Knie bis zum Kinn hochgezogen. Sie gönnte ihrer Schwester keinen Blick, sondern starrte mit finsterer Miene auf die Zimmerwand gegenüber.
»Amy? Was ist denn?«
Amy zuckte die Achseln.
Mary trat ins Zimmer und setzte sich auf den weißen Stuhl vor dem Schreibtisch. »Ist was passiert, Amy?«
»Nein ...«
»Wo ist Mutter?«
Wieder zuckte Amy die Achseln.
»Ist sie noch mit Shirley Thomas unterwegs?«
»Wahrscheinlich.«
Mary betrachtete forschend das mißmutige Gesicht ihrer Schwester. »Wie war's im Kino?«
»Ganz gut.«
»Was habt ihr euch angeschaut?«
Amy spielte mit ihren Haaren. »Frankie Avalon und Annette Funicello.«
»Amy, jetzt sei mal ehrlich. Was ist los?«
»Nichts.«
»Komm schon, Amy.«
Endlich drehte sie den Kopf. Ihre dunklen Augen blitzten zornig. »Ach, Dad wollte mich heute nachmittag vom Kino abholen, und dann ist er überhaupt nicht erschienen. Ich stand mir fast die Beine in den Bauch, und er kam nicht. Am Ende hab ich bei ihm im Büro angerufen, aber da konnten sie mich nicht verbinden, weil er gerade am Telefon war. Mit deinem Dr. Wade. Und als ich dann Mama anrufen wollte, hat sich gleich überhaupt keiner gemeldet. Mir blieb gar nichts anderes übrig, als den Bus zu nehmen, und dann bin ich bei dieser Affenhitze den ganzen Weg von der Haltestelle bis hierher zu Fuß gelatscht.«
»Du Arme.«
»Ja. Überhaupt paßt mir hier einiges nicht mehr«, fuhr Amy erbost fort. »Hier stimmt's doch hinten und vorne nicht. Das hab ich schon gemerkt, als du noch in Vermont warst. Mama und Dad waren immer so komisch, und nachts hab ich Mama weinen hören. Ich finde das furchtbar.«
»Ach, Amy ...«
Amys Lippen zitterten. »Und als ich ihnen erzählt hab, daß ich in Schwester Agathas Orden eintreten will, hat sie das überhaupt nicht interessiert. Dann bist du wieder heimgekommen, und jetzt ist alles ganz scheußlich hier.«
»Amy -«
Amy sprang vom Bett. »Ich existiere überhaupt nicht mehr für sie. Sie haben mich total vergessen.«
»Das ist nicht wahr!«
»Eben doch!« Amy hatte die Hände in die Hüften gestemmt. »Alles dreht sich nur um dich. Es ist ja auch viel wichtiger, daß du ein Kind bekommst, als daß ich Nonne werden will. Du und dein Kind, das ist das einzige, was Mama und Dad interessiert. Und du bist genauso.«
»Amy!«
Amy drehte sich um und rannte aus dem Zimmer. Mary sprang auf und lief ihr nach. Sie faßte Amy beim Arm.
»Bitte, lauf nicht vor mir weg.«
Amy fuhr herum und riß sich los. »Ich hab extra auf den richtigen Moment gewartet«, rief sie schluchzend, »um es ihnen zu sagen. Und weißt du, was sie gesagt haben? Darüber reden wir später. Das war alles.«
»Amy, das tut mir leid -«
»Ja, dir tut's leid. Hier dreht sich doch alles nur um dich, und dabei hast du gar nichts getan, um das zu verdienen.«
Mary wich einen Schritt zurück.
»Ich weiß schon, was du getan hast!« rief Amy. »Alle wissen es. Alle reden darüber. Und ich find nicht, daß es so toll ist, daß sie dich deswegen wie eine Prinzessin behandeln müssen. Mir graust schon davor, wenn das Baby auf der Welt ist und sich alle nur noch um dein und Mikes Kind kümmern.«
Mary senkte den Kopf. »Es tut mir leid, Amy«, sagte sie. »Wirklich, es tut mir leid, daß es so schlimm für dich ist. Aber es wird wieder besser, das verspreche ich dir. Ich hab nicht getan, was du glaubst und was die anderen sagen. Das Kind ist nicht von Mike. Mir ist etwas sehr Schönes und Wunderbares geschehen, und bald wirst du es auch verstehen, Amy, und dich mit mir freuen.«
Sie hörte, wie krachend die Haustür zufiel, und hob den Kopf. Sie stand allein im dunklen Flur.
»Ja, Mrs. Wyatt, wenn Sie uns für die Spendenaktion ihren Kombi zur Verfügung stellen würden, wären wir sehr dankbar. - Ja, ich gebe Ihnen dann Bescheid. - In Ordnung, Mrs. Wyatt, und nochmals herzlichen Dank. Auf Wiederhören.«
Pater Crispin verkniff es sich, den Hörer aufzuknallen, obwohl er große Lust dazu hatte. Statt dessen legte er ihn betont sachte auf, starrte aber dabei den Apparat so zornig an, als wäre der an seiner Mißstimmung schuld. Mit einer unwirschen Bewegung fegte er das Schreiben des Bischofs zur Seite, in dem dieser die Geistlichen seiner Diözese nachdrücklich darauf hinwies, daß die Politik auf der Kanzel nichts zu suchen hatte.
Politik! Nichts hätte Pater Crispin weniger kümmern können. Dieses Schreiben galt in erster Linie radikalen jungen Priestern, die statt des Evangeliums die Rassenintegration predigten. Der Bischof war ungehalten; im vergangenen Monat hatten sich mehrere Priester seiner Diözese an Studentendemonstrationen gegen die Rassentrennung beteiligt.
Zeitungen und Fernsehen hatten Aufnahmen von Priestern mit Transparenten gebracht.
Nein, diese Ermahnungen brauchte Pater Crispin nicht. Er achtete bei der Abfassung seiner Predigten auf Neutralität und vermied jede Kontroverse. Seine Sorgen waren von ganz anderer Art; sie waren bedrückender und weit persönlicher als die Diskussion darüber, ob man Schwarzen erlauben sollte, mit Weißen in einem Bus zu fahren.
In der Rückschau erkannte er, daß dieses Gefühl der Untauglichkeit schon lange in ihm rumorte, aber erst in jüngster Zeit war es ihm schmerzhaft bewußt geworden. Die kleine McFarland hatte es bloßgelegt; sie hatte die schützenden Schichten abgerissen, unter denen er seine Ängste verborgen gehalten hatte, und hatte die nackte Wahrheit aufgedeckt: daß Pater Lionel Crispin in der Tat ein untauglicher Seelsorger war, den niemand brauchte.
Zumindest quälte ihn dieses Gefühl seit jenem Tag, an dem er hatte einsehen müssen, daß er auf Marys katholisches Gewissen nicht den geringsten Einfluß besaß. Gestern dann hatte er, zornig und verärgert darüber, daß sie kein Geständnis abgelegt hatte, die Familie Holland aufgesucht und ein langes, ernstes Gespräch mit Nathan Holland geführt. Er hatte sich nach Kräften bemüht, Mike zu einem Geständnis seiner intimen Beziehungen zu Mary zu bewegen, damit diese sich endlich nicht mehr verpflichtet zu fühlen brauchte, ihn zu decken, und zur Beichte gehen konnte. Aber alle seine Bemühungen hatten nichts gefruchtet. Genau wie Mary hatte Mike immer wieder nur seine Unschuld beteuert.
Niedergeschlagen und mit einem Gefühl schrecklicher Unzulänglichkeit war Pater Crispin wieder gegangen. Im Lauf der darauffolgenden schlaflosen Nacht war ihm klargeworden, daß der >Fall< McFarland nur ein Symptom der ganzen elenden Misere war. Wenn er nicht fähig war, soweit auf zwei blutjunge Menschen seiner Gemeinde einzuwirken, daß sie eine einzige Sünde beichteten, wie war es dann um seine seelsorgerische Wirksamkeit auf die Gemeinde insgesamt bestellt?
Sein Groll auf sich und die Welt vertiefte sich noch, als er jetzt an den bevorstehenden Besuch dieses Arztes, Dr. Wade, dachte. Irgendwie, davon war Pater Crispin überzeugt, steckte dieser Mensch hinter Marys Weigerung zu beichten; möglicherweise unterstützte er sie sogar noch in ihrer Starrköpfigkeit.
Als es klopfte, blaffte er zornig »Herein« und stand hinter seinem Schreibtisch auf.
Jonas Wade blieb einen Moment auf der Schwelle stehen und wartete, bis seine Augen sich auf die Düsternis des Raums eingestellt hatten. Guter Gott, dachte er halb belustigt, halb entsetzt beim Anblick der flackernden Kerzen, der Heiligenbilder an den Wänden, der holzgeschnitzten Madonnen, das ist ja hier wie in einer mittelalterlichen Klause. Ist es möglich, daß jemand ernsthaft an dieses ganze Brimborium glaubt?
»Guten Tag, Dr. Wade. Bitte, nehmen Sie doch Platz.«
Jonas ließ sich auf dem unbequemen, steifen Lehnstuhl nieder und stellte die Aktentasche auf den Boden zwischen seine Füße.
»Ich nehme an, Dr. Wade, Sie sind hergekommen, um mit mir über Mary McFarland zu sprechen.«
»Wir stehen vor einem ernsten Problem, Pater Crispin. Ich bin hergekommen, um Sie um Hilfe zu bitten.«
Mit geschultem Blick musterte Jonas Wade den Mann, der ihm gegenübersaß. Ein eigensinniges Gesicht, scharfe kleine
Augen, die Haltung starr und abwehrend. Er ahnte, daß dieses Gespräch nicht einfach werden würde.
In aller Kürze berichtete er von Marys Besuch in seiner Praxis und ihrer wahnhaften Überzeugung, ihr Kind von einem Heiligen empfangen zu haben. Als er fertig war, schwieg er und wartete gespannt auf die Reaktion des Geistlichen.

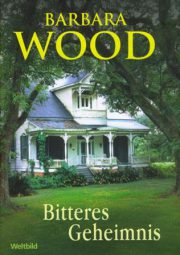
"Bitteres Geheimnis(Childsong)" отзывы
Отзывы читателей о книге "Bitteres Geheimnis(Childsong)". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Bitteres Geheimnis(Childsong)" друзьям в соцсетях.