Mary zitterte. »Ach, Amy ...«
»Weißt du, wer mich überhaupt auf den Gedanken gebracht hat, Mary? Du! Vor ein paar Jahren hast du zu mir gesagt, daß du Nonne werden willst, weil du den Menschen helfen möchtest. Ich war damals erst neun oder zehn, und fand es ziemlich blöd. Da muß man ja dauernd nur schwarzes Zeug anziehen, dachte ich, und schminken darf man sich auch nicht. Aber jetzt, im Firmunterricht, hab ich oft mit Schwester Agatha geredet, Mary. Und sie hat mir erzählt, was die Nonnen alles für tolle Sachen machen. Sie können als Krankenschwestern arbeiten, oder in der Mission. Sie müssen nicht nur in ihren Zellen sitzen und Altardecken nähen.
Und dann fiel mir wieder ein, was du über das Peace Corps gesagt hast, und daß du den Benachteiligten helfen willst. Ich dachte, daß ich das auch gern tun würde. Ich möchte so sein wie du, Mary, aber ich möchte es für Jesus tun. Verstehst du, was ich meine?«
Mary wäre am liebsten in Tränen ausgebrochen, vor der schwärmerischen Bewunderung und dem Idealismus in Amys leuchtenden Augen davongelaufen. Sie wußte nicht, was sie sagen sollte. Sie dachte nur voller Trauer, ach, Amy, werde nicht erwachsen.
»Also, was meinst du?« fragte Amy gespannt.
Mary brachte ein Lächeln zustande und schaffte es, mit ruhiger Stimme zu antworten. »Das ist eine große Entscheidung, Amy.«
»Ich weiß. Aber Schwester Agatha hat gesagt, wenn ich im Kloster bin, wird mir das die Entscheidung erleichtern. Sie hat gesagt, ich würde bestimmt eine gute Nonne werden, und sie hat auch schon mit ihrer Mutter Oberin über mich gesprochen. Mama und Daddy freuen sich bestimmt.« Amy kniff plötzlich die Augen zusammen und sah ihre Schwester scharf an. »Mary! Ist was?«
»Aber nein!« Mary lachte. »Ich finde das ganz toll. Ich freu mich mit dir.« Sie drückte Amys Arm.
»Komm doch mit, Mary. Tritt auch in den Orden ein.«
»Oh -« Ihr Lachen wurde nervös. »Wie soll ich denn Mike heiraten und gleichzeitig Nonne werden, hm?«
Amy grinste und nahm ihre Häkelarbeit wieder auf. »Stimmt ja. Ich bin froh, daß du's gut findest.«
Mary starrte auf Amys sich flink bewegende Finger und hörte ihre Schwester fragen: »Was wolltest du mir denn sagen, Mary?«
Die Tränen schossen ihr in die Augen. »Nur, daß du mir fehlen wirst«, antwortete sie leise.
»Hey!« Amy sah strahlend auf. »Das ist das erste Mal, daß du so was zu mir sagst.« Sie warf Mary die Arme um den Hals und drückte sie. »Du wirst mir auch fehlen.«
Mary merkte plötzlich, daß der Wagen langsamer fuhr. Sie waren vom Freeway abgefahren und befanden sich jetzt in einem Wohnviertel mit altmodischen Häusern. Immer noch Amys Worte in den Ohren, drückte sie die Stirn an die Fensterscheibe und kämpfte gegen die Tränen. Nicht jetzt. Nicht hier. Ich weine, wenn ich allein bin ...
Der Wagen hielt an. Sie sahen alle drei hinaus zu der hohen Hecke und dem kleinen, unauffälligen Schild, auf dem >St. Anne's Maternity Hospital< stand.
10
Der Tag war schwül und dunstig; die Kondensstreifen der Düsenmaschinen am Himmel färbten sich gelb, und die Palmen standen müde und schlaff. Jonas Wade, der im kühlen Sprechzimmer seiner Praxis saß, merkte nichts von der drückenden Hitze draußen. Vor einer Viertelstunde war sein letzter Patient gegangen; jetzt konnte er sich der Arbeit zuwenden, die ihn seit Wochen beschäftigte.
In seiner Aktentasche, die unter dem Schreibtisch zu seinen Füßen stand, waren der Hefter voller Aufzeichnungen, die fotokopierten Artikel, das etwas obskure Buch, das er in einem Antiquariat entdeckt hatte, und sein Notizbuch voller ungeordnet niedergeschriebener Gedanken und Überlegungen, die in lesbare Form gebracht werden mußten. Das ganze Projekt, wenn man es so nennen wollte, lief unter dem Arbeitstitel: >Parthenogenese beim Menschen: Eine Realität<.
Seit acht Wochen beschäftigte er sich mit diesem Thema, seit seinem ersten Gespräch mit Dorothy Henderson. In dieser Zeit hatte Jonas zahllose Stunden in der Bibliothek verbracht und jedes Wort, jeden Bericht, der seine Theorie untermauern konnte, gewissenhaft fotokopiert; er hatte Dorothy Henderson nochmals in ihrem Labor aufgesucht und sich danach im Encino Krankenhaus mit einem Spezialisten eingehend über die neuesten Verfahren zur Hautverpflanzung unterhalten. Aufgrund seiner Recherchen verdichtete sich seine Vermutung, daß Mary Ann McFarland in der Tat eine parthenogene-tische Mutter war, immer mehr. Gleichzeitig jedoch war er sich der Tatsache bewußt, daß seine ganze schöne Theorie in sich zusammenfallen würde, wenn er nicht einen entscheidenden Faktor miteinbezog: das Mädchen selbst.
Er wünschte jetzt, er wäre nicht so schnell bereit gewesen, sie ins St. Anne's Mütterheim schicken zu lassen, und hatte gleichzeitig ein schlechtes Gewissen, daß er das wünschte; er wußte, daß das St. Anne's für Mary das Beste war, ihr Verbleib zu Hause wäre nur für Jonas Wade von Vorteil gewesen.
Es klopfte kurz, dann öffnete seine Sprechstundenhilfe die Tür. »Dr. Wade? Würden Sie noch eine Patientin empfangen?«
Er zog die Brauen hoch und warf einen Blick auf seine Uhr.
»Jetzt noch? Es ist vier Uhr vorbei. Ich wollte gerade gehen. Hat die Frau einen Termin?«
Die Sprechstundenhilfe trat ins Zimmer und schloß die Tür hinter sich. »Es ist die kleine McFarland. Sie möchte unbedingt mit Ihnen sprechen.«
»McFarland? Mary Ann McFarland?« Jonas stand auf. »Schicken Sie sie herein.«
»Soll ich noch bleiben?«
»Nein, danke. Aber rufen Sie bitte meine Frau an, ehe Sie gehen, und sagen Sie ihr, daß ich mich etwas verspäten werde.«
Nachdem die Sprechstundenhilfe hinausgegangen war, setzte sich Jonas wieder, und als einen Moment später sich die Tür öffnete und Mary ins Zimmer trat, sah er ihr lächelnd entgegen.
»Hallo, Mary. Komm herein. Setz dich.«
Sie machte leise die Tür hinter sich zu, kam durch das Zimmer, stellte ihren kleinen Koffer ab und setzte sich in einen der Ledersessel vor seinem Schreibtisch.
Sie hatte sich verändert, seit er sie das letzte Mal gesehen hatte. Sie wirkte voller, rundlicher, war nicht mehr das gertenschlanke, etwas kantige junge Mädchen, das er bei ihrem ersten Besuch kennengelernt hatte. Das weiche braune Haar, das in der Mitte gescheitelt war, fiel ihr glänzend über die Schultern, die eine neue sanfte Rundung hatten. Als sie sich setzte, sah er flüchtig die leichte Schwellung ihres Bauches. Er fand sie fraulicher geworden, weicher.
»Das ist wirklich ein Zufall, Mary«, sagte er. »Ich habe gerade an dich gedacht. Wie geht es dir?«
»Dr. Wade, warum bin ich schwanger?«
Er antwortete nicht gleich. Sein Blick glitt zu ihren Handgelenken. Die Narben waren jetzt kaum noch zu sehen. Dann betrachtete er ihr Gesicht. Die Furcht und die Verwirrung, die er zuletzt in den großen blauen Augen gesehen hatte, waren nicht mehr da. Statt dessen sah sie ihn mit einer ruhigen Selbstsicherheit an, die ihn erstaunte. Die Wandlung, die mit dem Mädchen vorgegangen war, war bemerkenswert.
»Augenblick, Mary. Das letzte Mal warst du vor sieben oder acht Wochen bei mir. Damals hast du bestritten, schwanger zu sein.«
Sie nickte. »Das kann ich jetzt nicht mehr. Ich weiß, daß ich wirklich schwanger bin. Und ich möchte wissen, wieso.«
Jonas lehnte sich in seinem Sessel zurück. Er war erregt, aber er stellte seine Frage ganz sachlich. »Du glaubst also immer noch, daß du unberührt bist?«
»Ich weiß es.«
»Und was ist mit St. Anne's?«
»Da war ich die letzten sechs Wochen. Heute bin ich gegangen.«
»Ach?« Er schaute zu ihrem Köfferchen hinunter.
»Meine Freundin Germaine hat mich ein paarmal besucht und mir erzählt, welche Busse sie genommen hat. Ich hab's einfach umgekehrt gemacht.«
»Du bist mit dem Bus gekommen? Die weite Fahrt?«
»Ich mußte ja.«
»Aber - wo sind denn deine Eltern?«
Mary zuckte die Achseln. »Zu Hause, nehme ich an.«
»Wissen sie nicht, daß du von St. Anne's weg bist?«
»Nein.«
Jonas beugte sich abrupt nach vorn. »Du bist einfach aus dem Mütterheim weggegangen und direkt hierhergekommen? Ohne jemandem etwas zu sagen?«
»Ja.«
»Warum?«
»Weil ich nicht mehr dort bleiben wollte.«
»Ich meine, warum bist du direkt hierhergekommen? Warum bist du nicht nach Hause gefahren?«
»Weil ich wissen möchte, wieso ich schwanger bin. Sie sind der einzige, der mir helfen kann.«
»Mary -« Jonas setzte sich wieder tiefer in seinen Sessel und stieß dabei mit dem Fuß an seine Aktentasche. »Mary, du mußt nach Hause. Ohne Erlaubnis deiner Eltern kann ich nichts tun.«
»Das weiß ich. Aber ich mußte einfach zuerst zu Ihnen kommen. Ich meine, ehe ich meinen Eltern sage, was ich für mich beschlossen habe. Sie sind der einzige Mensch, an den ich mich wenden kann und dem ich vertraue. Ich kann meinen Eltern nicht allein gegenübertreten, Dr. Wade. Jetzt noch nicht.«
Sein Blick ruhte auf ihrem Gesicht. Er sah das Kindliche hinter der dünnen Fassade erwachsener Selbstsicherheit. Doch keine so tiefe Wandlung, dachte er. Bloß ein Kind, das sich die Maske der Erwachsenen aufgesetzt hat.
»Du brauchtest nicht aus dem Mütterheim wegzugehen, um mit mir sprechen zu können. Du hättest mich anrufen können. Ich wäre zu dir gekommen.«
Sie schüttelte den Kopf. »Doch, ich mußte weg. Ich will die Schwangerschaft zu Hause erleben. Ich möchte bei meinen Eltern und bei meiner Schwester sein. Sie sollen dazugehören.«
»Hast du dir mal überlegt, was sie davon halten werden?«
»Das ist mir gleich, Dr. Wade. Sie müssen mich einfach akzeptieren. Sie haben mich weggeschickt, weil sie meinen

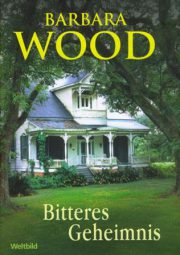
"Bitteres Geheimnis(Childsong)" отзывы
Отзывы читателей о книге "Bitteres Geheimnis(Childsong)". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Bitteres Geheimnis(Childsong)" друзьям в соцсетях.