»Nichts. Es drehte sich immer nur um Elritzen, Seeigel, Eidechsen und Vögel. Bei Geiern findet die Fortpflanzung in der Natur manchmal durch Parthenogenese statt. Darüber weiß ich jetzt eine ganze Menge. Aber über die höheren Tiere habe ich nichts gefunden.«
»Hm.« Bernie runzelte die Stirn und hüllte sich in Schweigen.
»Ich brauche deine Hilfe, Bernie.«
»Wozu? Bist du so sicher, daß das Mädchen die Wahrheit sagt? Schau mal, Jonas, die entscheidende Frage ist doch, ob Parthenogenese bei Säugetieren überhaupt möglich ist. Habe ich recht? Man kann von Truthühnern nicht einfach auf Menschen schließen. Aber -« er hob belehrend seinen dicken Zeigefinger - »von, sagen wir, Mäusen sehr wohl. O ja, ganz entschieden. Und ich glaube, ich weiß, wo du da was finden kannst.«
Bernie wischte sich die Hand an einer Papierserviette ab und zog ein in Leder gebundenes Notizbuch aus der Innentasche seines Tweedjacketts. Er klappte es ganz hinten auf und schrieb etwas hinein. Dann riß er die Seite heraus und reichte sie Jonas.
»Mit dieser Dame solltest du dich mal unterhalten. Sie ist hier an der Universität.«
Jonas las den Namen. »Henderson, Embryologin. Ist sie gut?«
»Eine Kapazität. Du kannst sie praktisch zu jeder Zeit in ihrem Labor erreichen. Dritter Stock. Du brauchst vorher nicht anzurufen. Sie hat gern Besuch und sie redet gern. Und wenn sie dir sagt, daß Parthenogenese bei Säugetieren nicht möglich ist, mein Freund, dann kannst du dich drauf verlassen, daß es stimmt, und kannst deine hirnverbrannte Idee endgültig ad acta legen.«
Es war ein glühend heißer Tag. Mary lag auf ihrem Bett und starrte zur Lampe in der Mitte der Zimmerdecke hinauf. Sie wünschte, sie hätte ein anderes Zimmer; ihres ging nach Süden. Nicht einmal die Klimaanlage, die das ganze Haus kühlte, brachte da viel Abhilfe.
Sie war heute morgen nicht zur Schule gegangen. Nach einer fast schlaflosen Nacht, in der sie stundenlang geweint hatte, war sie am Morgen mit rasenden Kopfschmerzen und starker Übelkeit erwacht. Obwohl sie seit dem vergangenen Mittag nichts gegessen hatte, hatten die Gerüche von gebratenem Schinken und Kaffee, die aus der Küche kamen, das Gefühl der Übelkeit nur verstärkt, und sie war gar nicht erst hinausgegangen. Sie hatte ihr Zimmer abgesperrt und war den ganzen Tag für sich geblieben. Daß ihre Mutter nach dem gestrigen Tag zum Alltag zurückkehren konnte, als wäre nichts gewesen, war ihr unbegreiflich.
Niemand war an ihre Tür gekommen. Niemand hatte sich die Mühe gemacht, nach ihr zu sehen. Sie hatte gehört, wie ihr Vater gegen elf weggefahren war, und hatte mittags Amy mit ihrem Schwimmzeug unter dem Arm davongehen sehen. Sie hatte gehört, wie ihre Mutter durch das ganze Haus gegangen war und alle Fenster geschlossen hatte, um dann die Klimaanlage einzuschalten. Danach war sie ins Schlafzimmer gegangen und hatte die Tür zugemacht.
Jetzt wurde es bereits dämmrig, und Mary lag immer noch in ihrem Zimmer. Auch ihre Mutter hatte sich nicht aus dem Schlafzimmer gerührt. Amy war bis jetzt nicht heimgekommen, und ihr Vater auch nicht.
Sie wartete mit Ungeduld und Furcht auf seine Heimkehr, um endlich zu erfahren, was er nun zu tun gedachte. Gestern abend hatte ihre Mutter ihm gesagt, er solle jemanden suchen, damit sie »das Ding loswerden« könnten.
Das Telefon läutete.
Sie lauschte. Nichts rührte sich im Haus. Beim dritten Läuten sprang Mary vom Bett und rannte hinaus. Sie lief zu dem Apparat in der Küche, weil der von den Schlafzimmern am weitesten entfernt war, und hob ab.
»Hallo?« meldete sie sich außer Atem.
»Mary?« Es war Germaine. »Wie geht's dir?«
Mary lehnte sich an die kühle Wand. »Hallo, Germaine.«
»Warum warst du heute nicht in der Schule? Alle haben nach dir gefragt.«
»Mir war wieder nicht gut.«
»Hat der Arzt denn nicht festgestellt, was dir fehlt?«
Mary seufzte. Seit jenem ersten Besuch bei Dr. Wade schien eine unendlich lange Zeit verstrichen zu sein. Germaine wußte von diesem Besuch, aber nicht von dem Befund und auch nicht von dem zweiten Besuch bei Dr. Evans.
»Nein. Es scheint was ganz Mysteriöses zu sein.«
»Hey, wir haben heute unsere Zeugnisse bekommen. Stell dir vor, in Französisch hab ich ein B. Ist das nicht toll? Die fand meinen Aufsatz über den Existenzialismus tatsächlich
gut. Mary? Hörst du mich überhaupt?«
»Ja.«
»Kommst du morgen wieder?«
»Ich weiß noch nicht.«
»Es ist der letzte Tag, Mary, du weißt doch, da geht's immer hoch her.« Einen Moment trat Schweigen ein. »Okay, dann mach ich jetzt mal Schluß. Ich warte morgen an der Fahnenstange auf dich wie immer, ja?«
»Ja.«
»Und wenn du was brauchst, dann ruf mich an, okay?«
»Ja. Danke.«
Den Hörer in der Hand behaltend, obwohl Germaine aufgelegt hatte, stand Mary da und sah sich wie eine Fremde in der Küche um. Mehrere Schubladen standen offen, auf der Anrichte waren Kaffeeflecken, die Butter auf dem Tisch war halb geschmolzen. Sie drückte auf die Gabel des Telefonapparats, wartete, bis das Freizeichen kam und wählte dann beinahe mechanisch Mikes Nummer.
Timothy meldete sich. »Hier ist das Weiße Haus. Sie wünschen bitte?«
»Hallo, Timmy, ich bin's, Mary. Ist Mike da?«
»Ja, warte, ich hol ihn.«
Sie hörte den Jungen laut nach Mike rufen, hörte eine gedämpfte Antwort, dann wieder Timothys Stimme, »Es ist Mary«. Sie rutschte an der Wand hinunter, bis sie auf dem Boden hockte, und wartete darauf, daß Mike sich melden würde.
»Hallo«, sagte er endlich.
»Mike?« Mary umklammerte den Hörer so fest, daß ihre Finger weiß wurden. »Mike, kannst du gleich mal rüberkommen?«
Seine Stimme kam von weit her. »Mary - ich wollte dich gerade anrufen.«
In seinem Ton war eine Schwingung, die sie beunruhigte. »Mike«, flüsterte sie, »war mein Vater heute bei euch?«
Eine Pause. Dann sagte er: »Ja.«
Sie schluckte. »Dann - weißt du es?«
»Ja.«
Sie schloß die Augen. »Ich muß unbedingt mit dir reden.«
»Ja, Mary, ich will auch mit dir reden. Mary ...« Seine Stimme klang gepreßt und undeutlich, wie durch Watte. »Mein Gott, Mary, ich war total geschockt. Echt, ich hab den ganzen Tag an nichts anderes denken können. Ich meine, es ist so, so unfaßbar, verstehst du? Mary, eins muß ich wissen.«
»Was denn?«
»Mit wem hast du's getan?«
Sie riß die Augen auf. Ihr Blick flog durch die Küche; die Unordnung, die ihre Mutter hinterlassen hatte - so untypisch für sie.
»Mike«, sagte sie angespannt, die Knie bis zur Brust hochgezogen. »Mike, ich hab nichts getan. Ich schwör's dir, ich hab nichts getan. Mit niemandem. Was die Ärzte sagen, ist nicht wahr. Sie irren sich. Aber ich hab solche Angst, und meine Eltern glauben mir nicht. Ich hab keinen Menschen.« Mary schossen die Tränen in die Augen. Sie sah die Küche nur noch wie durch einen Schleier. »Mike, du mußt herkommen, ich brauch dich.«
»Ich kann nicht, Mary. Jetzt nicht -«
»Dann komm ich zu dir. Oder wir treffen uns irgendwo. Ich muß dir das alles erklären. Wir müssen drüber reden. Ich werd damit allein nicht fertig. Ich weiß nicht, was los ist.«
Mary lauschte auf die Stille und mißverstand sie. »Ach, Mike«, flüsterte sie, »bitte tu mir das nicht an .«
Schluchzend sagte er: »Es tut mir so leid, Mary - so verdammt leid. Ich - ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Mary!« rief er. »Es ist mir gleich, ehrlich. Ich steh zu dir, ich schwör's dir. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich heirate dich auch, aber ich muß es wissen. Ich muß es wissen, Mary.« Er hatte Mühe, die Worte herauszubringen. »Warum ein anderer? Warum nicht ich?«
»Mike, bitte! Du verstehst mich nicht. Und ich weiß nicht, wie ich es dir verständlich machen soll.«
»Mary, wenn du mich liebst -« er kämpfte um seine Beherrschung - »wenn du mich liebst, dann sei ehrlich mit mir. Wir müssen aufrichtig zueinander sein, das waren wir doch immer. Keine Geheimnisse, Mary, darum geht's doch, wenn man sich liebt. Wir stehen das gemeinsam durch, ich versprech es dir, aber laß mich nicht außen vor, lüg mich nicht an.«
»Ich lüge nicht -«
»Deinem Vater kannst du erzählen, was du willst, aber mir mußt du vertrauen, Mary. Weißt du eigentlich, wie weh mir das tut? Es tut gemein weh, dich zu lieben und zu wissen, daß du es mit einem anderen getan hast und mir nicht mal so viel Vertrauen entgegenbringst, daß du mir die Wahrheit sagst -«
»Aber ich hab doch gar nicht -«
»Das ist wirklich das Schlimmste! Daß du mir nicht die Wahrheit sagst. Vertrau mir doch, Herrgott noch mal!«
Wieder schloß Mary die Augen und leckte sich die Tränen von den Lippen. Einen Moment lang war die Versuchung groß
- ihm irgend etwas zu erzählen, eine Geschichte zu erfinden, einen anderen Jungen, einen Freund von Germaine vielleicht, einen Freund ihres Freundes Rudy. Wir haben was getrunken, und eigentlich wollte ich gar nicht, und es war auch gar nicht schön, aber nun hab ich's mal getan, und es tut mir leid, du hast keine Ahnung, wie sehr ich es bereue, Mike. Dann würde Mike herüberkommen und sie in die Arme nehmen und trösten ...
»Mike.« Ihre Stimme war ernst und ruhig. »Ich sage dir die Wahrheit. Ich habe nichts getan. Mit niemandem. Sag, daß du mir glaubst.«
Seine Stimme war verzerrt. »Ich kann nicht mehr reden. Ich kann jetzt nicht mehr, Mary. Ich muß nachdenken. Ich muß mir überlegen, was ich tun soll. Alle - mein Vater und meine Brüder - glauben, das Kind wäre von mir. Ich muß nachdenken, Mary.«
Marys Mund formte die Worte: Ich bekomme kein Kind. Aber ihre Stimme versagte.
Mike sprach stockend weiter. »Ich kann jetzt nicht mit dir sprechen, Mary. Ich muß mir selbst erst klar werden, was ich tun soll. Ich muß erst mal mit mir selber zurechtkommen, verstehst du? Wir müssen zusammenhalten, Mary, aber du willst nicht, du hast kein Vertrauen zu mir, und ich - ich -«

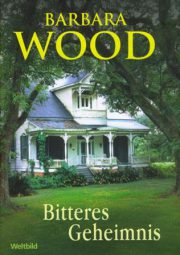
"Bitteres Geheimnis(Childsong)" отзывы
Отзывы читателей о книге "Bitteres Geheimnis(Childsong)". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Bitteres Geheimnis(Childsong)" друзьям в соцсетях.